Als der Medienwissenschaftler Norbert Bolz, dem man kaum extremistische Neigungen zuschreiben kann, jüngst Besuch von der Berliner Polizei erhielt, weil er in einem satirischen X-Beitrag eine nationalsozialistische Parole parodiert hatte, war die Reaktion vorhersehbar: Viele Beobachter sprachen von einem Missbrauch des Rechtsstaats und der Instrumentalisierung staatlicher Mittel, um Kritiker und Oppositionelle einzuschüchtern. Mit dieser Annahme liegen diese Kommentare jedoch daneben, denn es handelt sich nicht um das außer Kontrolle geratene Verhalten eines ansonsten funktionsfähigen Systems. Sie verkennen die innere Logik jener Ordnung, die derartige Eingriffe strukturell ermöglicht. Die stetig anschwellende Welle repressiver Maßnahmen ist demnach kein Betriebsunfall, sondern die Konsequenz: Sie ist in die DNA der bundesrepublikanischen Konstruktion eingeschrieben.
„Wehrhafte Demokratie“: Schutzidee mit eingebauter Ausweitungstendenz
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung versteht sich seit den Anfängen der Bundesrepublik Deutschland als „wehrhafte Demokratie“. Aus der historischen Erfahrung der totalitären Verbrechen des Nationalsozialismus erwuchs die Überzeugung, dass eine politische Ordnung, die alles duldet, auch jene Kräfte dulden muss, die sie beseitigen wollen, wodurch sie sich selbst gefährdet. Dementsprechend wurde Demokratie bei der Staatsgründung der Bundesrepublik nicht nur formal definiert – als Verfahren, Wahlen, Gewaltenteilung –, sondern auch materiell als Werteordnung, deren Verteidigung dem Staat obliegt. Zu diesem Zweck wurden Instrumente geschaffen, die über das klassische Strafrecht hinausreichen. Dazu zählen Nachrichtendienste wie der Verfassungsschutz, die verfassungsgerichtliche Parteiverbotskompetenz und – zentral für das hier behandelte Thema – Strafnormen, die bestimmte Symbole, Parolen und Äußerungen unabhängig vom Kontext unter Strafe stellen.
Diese Architektur war in der unmittelbaren Nachkriegszeit politisch nachvollziehbar. Eine junge Republik, deren gesellschaftliche Textur von ideologischen Altlasten durchzogen war, mochte ein robustes Frühwarn- und Abwehrsystem für plausibel halten. Vier Generationen später jedoch sind die historischen Träger jener Bewegungen marginalisiert oder verschwunden, die Bundesrepublik ist gefestigt und die Mehrheitsgesellschaft bekennt sich – allen verfügbaren Indikatoren nach – zu demokratischen Normen. Dennoch ist in den letzten Jahren eine Rhetorik allgegenwärtig geworden, die von einer permanenten Gefährdung „der Demokratie“ spricht – meist diffus „von rechts“. Dass sich diese Alarmformel weniger auf die Verfassungsstruktur als vielmehr auf die Machtarchitektur des gewachsenen Parteistaats bezieht, bleibt dabei unausgesprochen.
Die Versuchung zur Disziplinierung
Der verfassungsrechtliche Auftrag der Parteien, an der politischen Willensbildung mitzuwirken, hat sich historisch zu einem System verfestigt, in dem die etablierten Kräfte – Union, SPD, Grüne, FDP und Linkspartei – tief in Institutionen und Deutungsräume hineinwirken: in Medien und Verbände, in Verwaltung, Justiz und Hochschulen. Opposition ist darin durchaus vorgesehen, allerdings als kontrollierbarer Gegenpart innerhalb eines begrenzten Korridors. Wenn neue Kräfte dieses Gleichgewicht jedoch real gefährden, wächst die Versuchung, die Instrumente der Wehrhaftigkeit nicht länger defensiv als Schutzschild gegen tatsächliche Extremismen, sondern offensiv als Disziplinierungswerkzeuge gegen unliebsame Positionen einzusetzen.
Vorfälle wie Hausdurchsuchungen wegen satirischer Verfremdungen, Verfahren wegen zugespitzter Kritik an Migrationsfolgen oder Debatten über „Politikerbeleidigung“ sind in dieser Lesart keine Ausreißer, sondern Symptome eines Systems, das Dissens nicht mehr integrieren, sondern neutralisieren will.
§ 86a und § 130 StGB: Vom Schutzwall zum Gummiband
In diesem Gefüge kommt den Paragrafen § 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) und § 130 StGB (Volksverhetzung) eine Schlüsselrolle zu. Ursprünglich waren diese eng umrissenen Schutzbestimmungen dazu gedacht, offene Propaganda totalitärer Organisationen zu unterbinden beziehungswise Aufrufe zu Hass und Gewalt gegen Gruppen zu sanktionieren. In der Praxis haben beide Normen jedoch eine Ausweitung erfahren, durch die der Sinnkontext einer Äußerung zunehmend in den Hintergrund gedrängt wird. So wird die bloße Verwendung eines historischen Kennzeichens, selbst zu kritischer, entlarvender oder satirischer Absicht, kriminalisierungsfähig. Und der Volksverhetzungstatbestand wird teilweise so weit ausgelegt, dass zwischen grober Polemik, scharfer Tatsachenkritik und tatsächlicher Aufstachelung zu Feindseligkeit kaum mehr trennscharf unterschieden wird.
Gerade § 86a verführt zur Kontextblindheit, da er die formale Geste – das Symbol, die Parole, das Zeichen – aus dem Bedeutungszusammenhang zieht und sie kriminalisiert, als ob Sprache und Zeichen nicht wesentlich von Intention, Zielrichtung und Kommunikationssituation lebten. § 130 wiederum tendiert, je nach Anwendung, zum Gummiparagrafen, dessen Reichweite sich am jeweils gültigen Meinungsklima orientiert. Beides führt zu einer Kältezone des Diskurses, in der der vorauseilende Selbstschutz – besser schweigen als riskieren – zur Tugend erklärt wird.
Von der Abwehr des Extremismus zur Kontrolle des Dissenses
Der Übergang von defensiver Gefahrenabwehr zu aktiver Diskurssteuerung verläuft schleichend: Zunächst befasst man sich mit eindeutig illegitimen Inhalten, dehnt dann die Anwendungslogik auf Grenzfälle aus und endet schließlich mit der Sanktionierung unpassender Töne, zugespitzter Formulierungen oder ironischer Zitate. Diese Bewegung wird durch außerstaatliche „Meldestellen“ und zivilgesellschaftliche Kampagnen unterstützt, die einen moralischen Druck erzeugen, dem sich Behörden nur ungern indifferent zeigen. Das Ergebnis ist ein informelles Zusammenspiel aus Empörungsökonomie, Erregungsmedien und vorsorgender Strafverfolgung. Dieses vermittelt zwar den Anschein entschlossener Wehrhaftigkeit, unterminiert aber tatsächlich die geistige Selbstständigkeit der Bürger.
Wer in dieser Lage lediglich die Rückkehr der „Vernunft in den Behörden” einfordert, unterschätzt die Strukturkraft des Problems. Auch ein mäßigender Innenminister, der situativ Zurückhaltung predigt, repariert allenfalls die Oberfläche, während die Ausweitung logisch intakt bleibt. Echte Reform setzt tiefer an: Sie muss die Befugnis zur Kriminalisierung von Meinungen dort zurücknehmen, wo sie den Kern republikanischer Öffentlichkeit trifft.
Ein Republikanismus des Vertrauens statt ein Paternalismus der Angst
Die Alternative zur Strafbarkeit missliebiger Rede ist nicht Wehrlosigkeit, sondern Vertrauen. Vertrauen in die Fähigkeit der Bürger, Geschmacklosigkeit von Gefährlichkeit zu unterscheiden. Vertrauen in die Kraft der öffentlichen Gegenrede, die Irrtümer und Übertreibungen besser korrigiert als das Strafgericht. Und schließlich Vertrauen in rechtsstaatliche Mittel, die tatsächliche Bedrohungen wie Gewaltaufrufe, Nötigung und konkrete Gefahren längst adressieren. Ein Gemeinwesen, das Meinungsfreiheit nicht als Gnade, sondern als Grundlage begreift, hält das Risiko der Freiheit aus, weil es weiß, dass der Preis der Vorzensur höher ist als der Preis der Zumutung.
Dazu gehört, § 86a aufzuheben, weil eine demokratische Ordnung die Kontextkompetenz der Bürger unterstellt und nicht deren Unmündigkeit, sowie § 130 zu streichen, weil die Grenze legitimer Äußerungen bereits durch bestehende Normen wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung oder die öffentliche Aufforderung zu Straftaten gezogen wird, ohne dass es eines allzweckhaften Meinungstatbestands bedarf, der den Diskurs verengt. Wer befürchtet, der Wegfall dieser Paragrafen entwaffne den Staat, übersieht, dass der Werkzeugkasten des Strafrechts und des Polizeirechts reich bestückt ist, wenn es um konkrete Rechtsgutsverletzungen geht. Was entfiele, wäre vor allem die Sanktionslust gegenüber Symbolen und Worten.
Der Verfassungsschutz als Katalysator
Die Tendenz zur Gesinnungskontrolle wird durch die Funktionslogik des Verfassungsschutzes verstärkt. Eine Behörde, deren Auftrag in der Beobachtung „verfassungsfeindlicher Bestrebungen“ liegt, kann sich dem Druck politischer Deutungen kaum entziehen. Denn bereits die Beobachtung wirkt – unabhängig vom Ergebnis – stigmatisierend und verengt den Meinungskorridor sichtbar. Eine rein technische Reform hilft hier wenig, solange Beobachten und Bewerten untrennbar miteinander verbunden sind. Wer die geistige Souveränität der Öffentlichkeit stärken will, muss daher auch hier Kompetenzen abbauen, Verantwortlichkeiten klarer justiziabel machen und die Rolle des Nachrichtendienstes streng auf tatsächliche Gefahrenlagen begrenzen – oder konsequent gedacht, seine Auflösung erwägen.
Gegen diese Linie werden zwei Einwände regelmäßig vorgebracht. Erstens sei das Land heute so polarisiert, dass ohne § 130 hassgetriebene Kampagnen aus dem Ruder liefen. Doch Hass ist kein Rechtsgut und wenn aus Worten Taten werden, greifen längst tatnahe Straftatbestände. Zweitens wird eingewandt, ohne § 86a drohe die schleichende Normalisierung extremistischer Symbolik. Doch Normalisierung wird nicht durch Tabu-Jagd verhindert, sondern durch Argumente. Eine Demokratie, die ihren Bürgern nicht zutraut, Ironie von Propaganda zu unterscheiden, bezweifelt damit ihre eigene Reife.
Freiheit sichern heißt Strafbarkeit begrenzen
Die Bundesrepublik Deutschland kann zu Recht stolz auf ihre Stabilität sein. Doch Stabilität ist kein Selbstzweck, wenn sie mit einer Verengung der Meinungsräume erkauft wird. Der Weg zurück zu einer republikanischen Öffentlichkeit führt nicht über moralisierende Appelle, sondern über eine konkrete rechtliche Entschärfung. Wer die Freiheit ernst nimmt, muss ihre Feinde nicht lieben, aber aushalten, dass Sprache mitunter grell, verletzend, töricht oder geschmacklos ist. Das Mittel dagegen ist Widerspruch, nicht Strafrecht.
Darum ist es folgerichtig, § 86a und § 130 StGB ersatzlos zu streichen. Nicht, weil Extremismen zu verharmlosen wären, sondern weil eine Demokratie, die Meinungen unter Strafe stellt, auf Dauer mehr verliert, als sie gewinnt. Sie verliert die Selbstkorrekturfähigkeit der offenen Debatte und erzieht ihre Bürger zur Vorsicht statt zur Urteilskraft. Ein Staat, der seine Bürger vor Worten schützt, schützt sich nicht vor Extremismus, sondern vor Kritik. Und eine Ordnung, die Kritik fürchtet, hat den Ursprung ihrer Stärke bereits missverstanden.
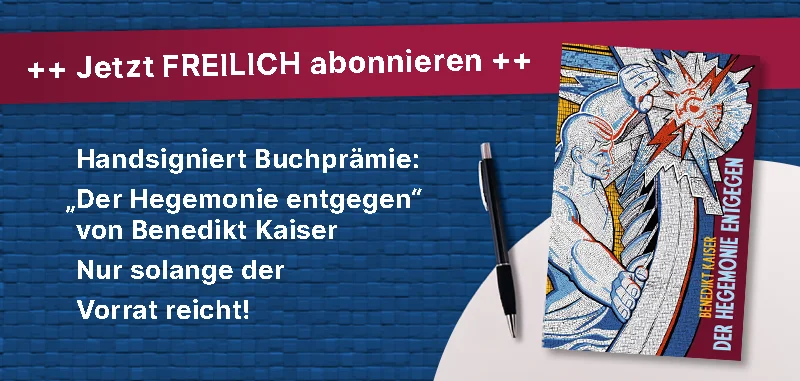
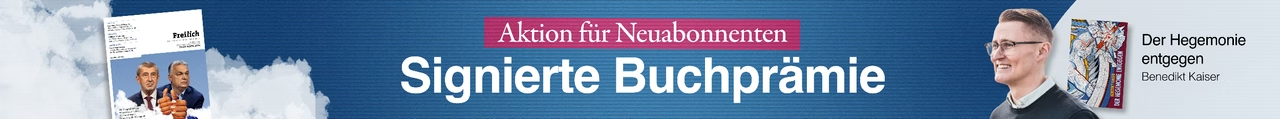

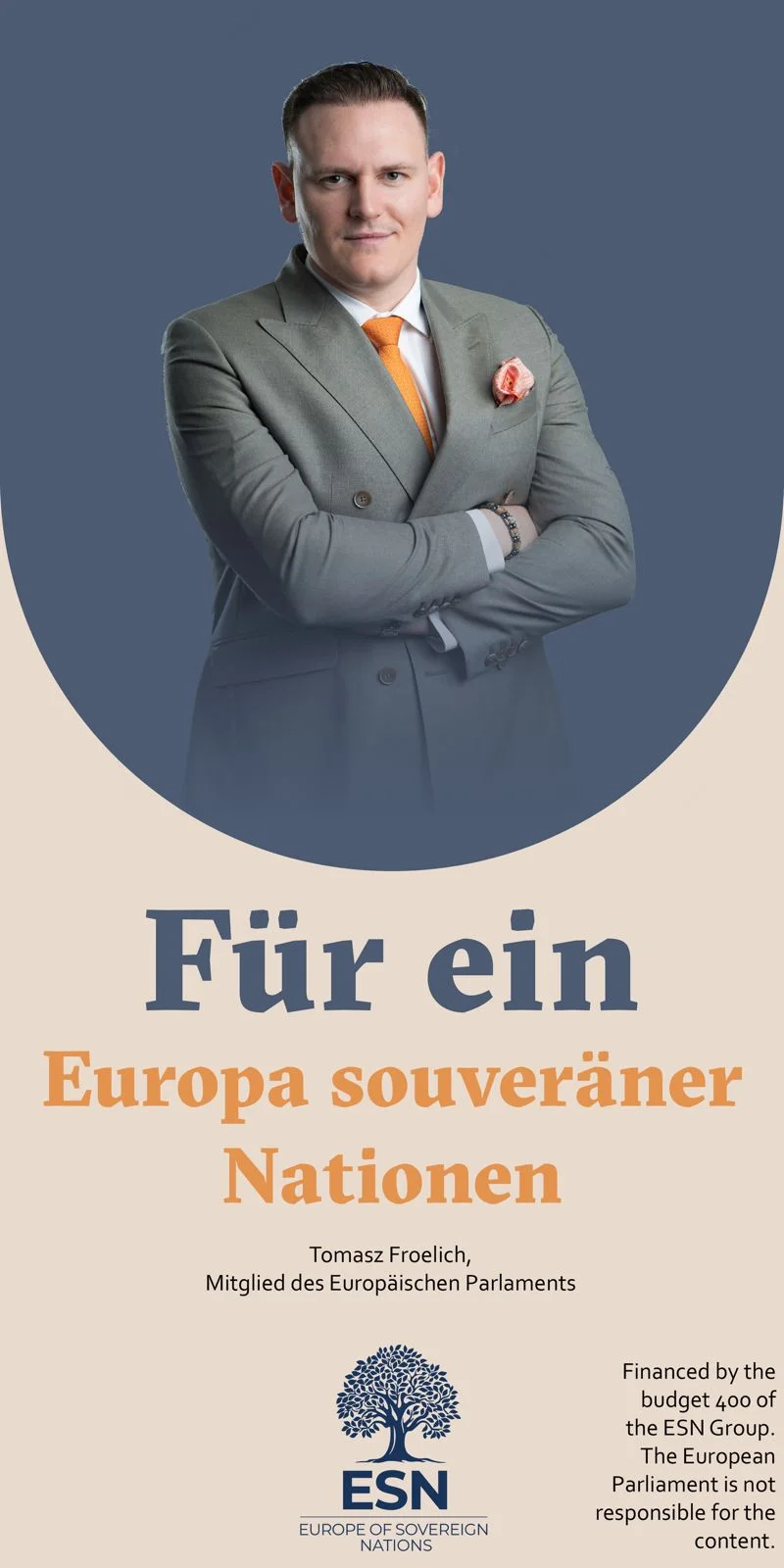

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!