Die Niederlande haben gewählt. Zwar wurde in den Nachwahlbefragungen zunächst die D66 mit Rob Jetten als deutlich stärkste Kraft angekündigt, doch konnte sich die PVV noch ein wenig stabilisieren und wird mit einem hauchdünnen Abstand fast gleichauf mit D66 ins Ziel kommen. Dabei kam es zu drastischen Verschiebungen in der niederländischen Parteienlandschaft. So gewinnt D66 17 Sitze, während Wilders mit der PVV als bisherige, mit Abstand stärkste Kraft, elf Sitze gegenüber dem letzten Wahlergebnis verliert und sogar 22 Sitze weniger erreicht als zum absoluten Umfragehoch.
Das NSC wurde vollständig pulverisiert und versank von 20 Sitzen auf null – und das alles binnen zwei Jahren seit der letzten Wahl. Die Volatilität in den Niederlanden ist hoch. Die Demokratie ist schnelllebiger, die Parteienbindung weniger stark als in Deutschland und regelmäßig schießen neue Parteien aus dem Boden, um dann wieder zu verschwinden. Zwei prominente Beispiele dafür aus der Vergangenheit sind das FvD (Forum voor Democratie) und die BBB (BoerBurgerBeweging – „Bauer-Bürger-Bewegung“). Beide Parteien erreichten temporäre Umfragehöhen, konnten die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Dies ist nun auch dem NSC passiert.
Warum sind die Niederlande strukturell so anders?
Und warum ist die niederländische Demokratie so anders als beispielsweise die deutsche? Um dies zu verstehen, muss man einige Eigenheiten der Niederlande kennen. Ein Grund ist die geringe Größe des Landes. Im Gegensatz zu Deutschland hat das Land gerade einmal 18 Millionen Einwohner. Es hat viel weniger „Top-down“-Strukturen als Berlin. Die Strukturen sind lokaler – man könnte fast sagen: „Man kennt sich“. Dies wird auch daran ersichtlich, dass es nur drei Städte mit über 500.000 Einwohnern gibt. Dies sind Den Haag, Rotterdam und natürlich Amsterdam.
Das Verhältnis ist zwar ähnlich wie in Deutschland, jedoch leben dort nur ca. zehn Prozent der Gesamtbevölkerung in Städten dieser Größe. In Deutschland sind es etwa 20 Prozent. Das Land hat also auch strukturell einen Vorteil für konservative Bewegungen. Das Leben ist entschleunigter. Wer schon häufiger in den Niederlanden gewesen ist, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Niederländer grundsätzlich einen positiven Nationalbezug pflegen und konservativer sind als viele Teile der BRD.
Ein heterogenes Parlament
Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass es keine Fünf-Prozent-Hürde oder Ähnliches gibt. Das Parlament hat 150 Sitze und sobald eine Partei mindestens 0,67 Prozent der Stimmen erreicht, erhält sie auch eine parlamentarische Repräsentanz. Dies führt häufig dazu, dass Koalitionsbildungen in den Niederlanden knifflig sind. Vier-Parteien-Bündnisse sind hier eher die Regel als die Ausnahme.
Des Weiteren werden entstandene Lücken in der Parteienlandschaft durch dieses System rasant geschlossen. Der Wähler hat mehr Auswahlmöglichkeiten. Umso erstaunlicher war das Umfragehoch von Wilders mit zwischenzeitlich 48 prognostizierten Sitzen. Das ist für die Niederlande eine Seltenheit und zeigt, dass eine solche Stärke aus logischen Gründen fast zwangsläufig Teil einer Regierung sein müsste – schließlich gibt es 15 Parteien im Parlament.
Die Fehler Wilders und ihre Folgen
Die PVV verliert etwa sieben Prozent der Stimmen und schrumpft auf 26 Sitze. Auf den ersten Blick scheint das rechte Lager der Verlierer der Wahl zu sein. Bei genauerer Betrachtung der Sitzverteilung zeigt sich jedoch, dass dies nicht der Fall ist: PVV, JA21 und FvD kommen zusammen nun auf einen zusätzlichen Sitz.
Die parlamentarische Größe wächst von 41 auf 42 Sitze, was einem Anteil von 28 Prozent entspricht. Wie es dazu kam: Wilders hatte zuvor die Koalition gesprengt und sieht sich jetzt Fliehkräften innerhalb des rechten Lagers ausgesetzt. Diejenigen, die sich für eine noch schärfere Kante in der Migrationspolitik und eine nicht an Israel gebundene Politik aussprechen, hat die PVV an das FvD verloren (vier Sitze). JA21 gewann viele der wütenden Wähler Wilders, die zuvor Ingrid Coenradie gewählt hatten. Sie war bis Juni 2025 für die PVV aktiv, verließ diese aber aufgrund ihres Unmuts gegenüber Wilders.
Mit ihr gewann die JA21 eine charismatische Persönlichkeit, die vorwiegend auf eine erneute Regierungsbeteiligung abzielt. Dazu gibt sie sich ein wenig moderater als Wilders, hat aber ein klares rechtes Profil. Durch Wilders’ Aufkündigung der Koalition hat vor allem er selbst massiv Zustimmung verloren, während sich der grundsätzliche Anti-Migrations-Trend in den Niederlanden dadurch nicht gebrochen sieht.
Relevant für die AfD
Hieraus muss primär die AfD lernen. Wilders ging zuvor eine Koalition ein, in der er einiges umsetzen konnte, seine Kernversprechen und Themen jedoch nicht. Dies war bereits im Voraus klar und es überraschte kaum jemanden, dass er die gewünschten Reformen in der damaligen Koalition nicht durchsetzen konnte. In der naiven Annahme, dies sei für die Wähler ebenfalls ersichtlich und er könne sich als Hardliner behaupten, sprengte er die Regierung und trat zurück.
Zurück blieben hauptsächlich enttäuschte Wähler, die fast zwei Jahrzehnte – die PVV wurde 2006 gegründet – darauf gewartet hatten, dass endlich etwas passiert, und vor allem erwarteten, dass Wilders die Regierungsverantwortung ernst nehmen würde. Während Kickl aus demselben Grund, aus dem Wilders später zurücktrat – nämlich dass er seine Kernthemen nicht würde umsetzen können – die Regierungsbeteiligung zusammen mit der ÖVP ablehnte, wird die Dualität dieses Entscheidungsmodells offensichtlich. Der Weg von Kickl führte die FPÖ von 28 Prozent zu 38 Prozent in den Umfragen und ihn selbst in Kanzlerumfragen auf über 40 Prozent, während Wilders fast zehn Prozent verlor und damit drastisch an politischem Gewicht eingebüßt hat.
Zudem hat er den Weg Melonis nicht eingeschlagen und daher die Chance vertan, sich innerhalb dieser Regierungsbeteiligung auf Volksebene längerfristig zu etablieren. Für die PVV ist fast das Worst-Case-Szenario eingetreten. Dies darf der AfD keinesfalls passieren, da die Lage besonders im Westen zunehmend drastischer wird und wir uns Fehltritte dieser Art nicht leisten dürfen. Wir müssen den Kickl-Weg gehen. Den harten Weg, aber dafür den nachhaltigen!
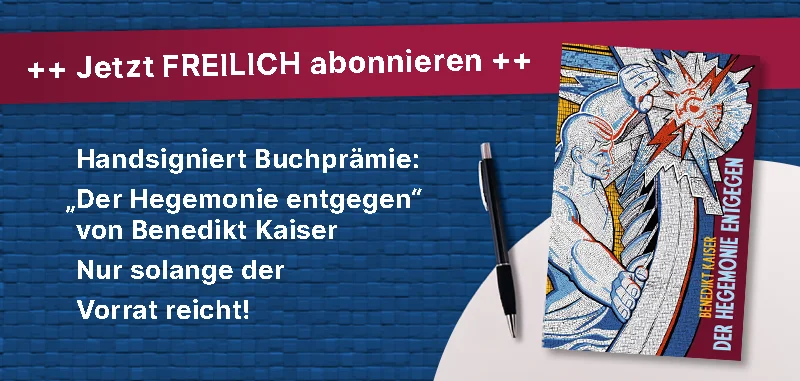
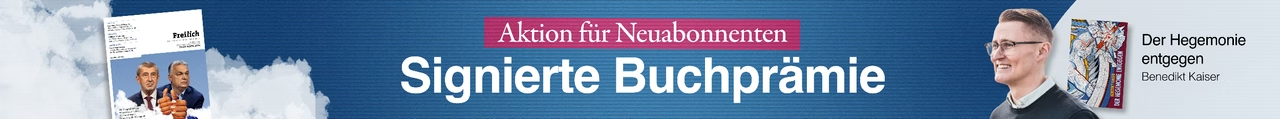
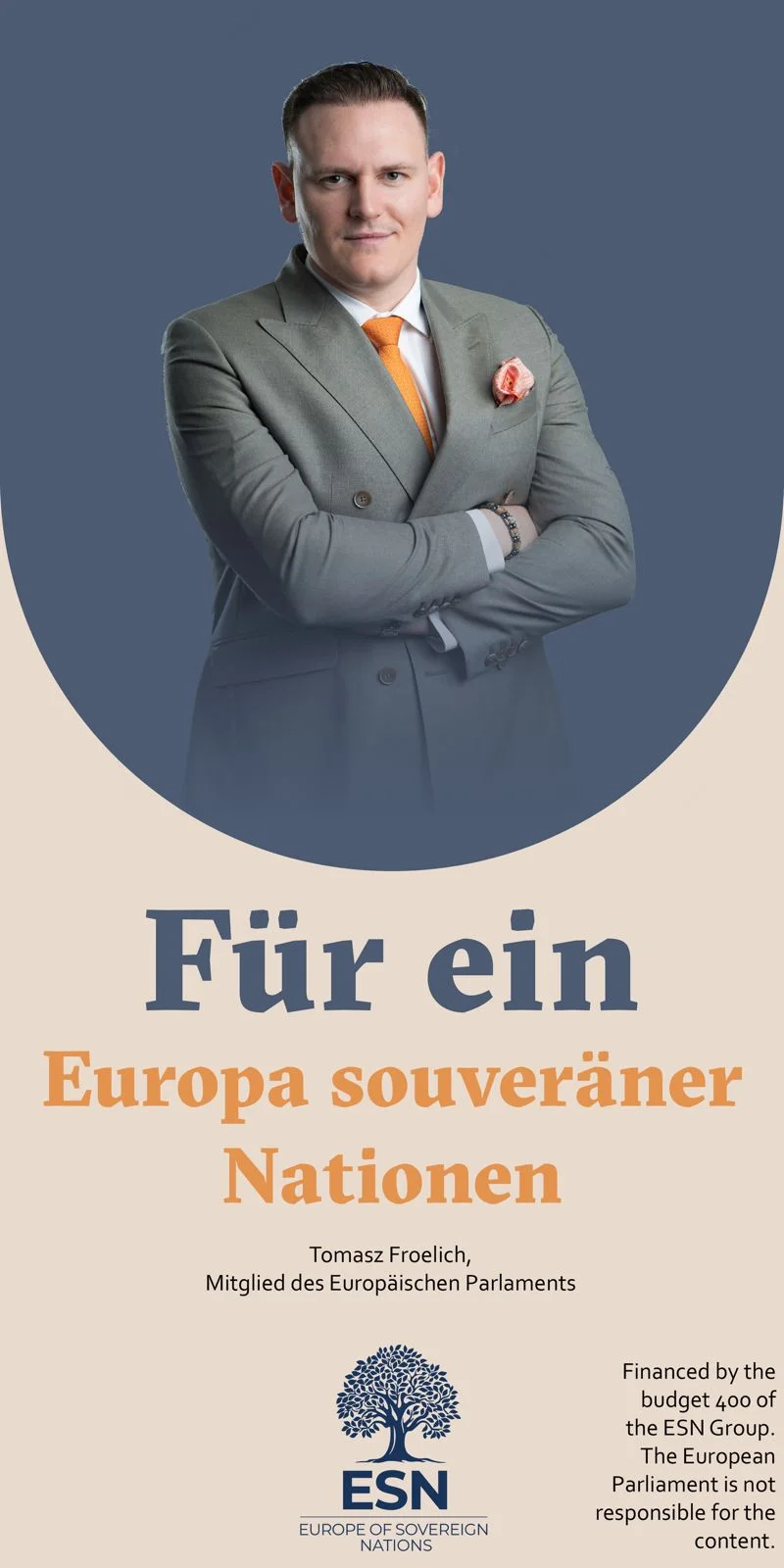

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!