Man kann förmlich die Uhr danach stellen, wie aus Polen in regelmäßigen Abständen Forderungen nach deutschen Reparationszahlungen laut werden. So auch jetzt wieder vom polnischen Präsidenten Karol Nawrocki, der meinte: „Die Frage der Reparationen ist natürlich nicht rechtlich abgeschlossen.“ Aktuell kursiert die Zahl von 1,3 Billionen Euro, die in einem Gutachten erhoben wurden. Allein der Umstand, dass so ein Gutachten vor drei Jahren erstellt wurde, zeigt, dass Polen noch lange nicht mit dem Thema abgeschlossen hat. Von der polnischen Verzichtserklärung 1953, die 1970 im Warschauer Vertrag bestätigt wurde, wollen gewisse polnische Kreise bewusst nichts mehr wissen. Und auch, dass kein Einspruch im Zuge des 2+4-Vertrags 1990 erhoben wurde, wird unterschiedlich gedeutet.
Zwischen Forderungen und Feindbildern
Das polnisch-deutsche Konfliktpotenzial endet aber nicht bei polnischen Reparationsforderungen, sondern manifestiert sich vor alle auf polnischer Seite in Form eines offenbar tief verankerten Deutschenhasses, der sich mit Chauvinismus und Revanchismus sowie durchaus weit verbreiteten Großmachtträumen vermischt. Jüngstes Beispiel hierfür ist der PiS-Bürgermeister von Myślenice, Jarosław Szlachetka, der bei einer Parteiveranstaltung Dartpfeile auf eine Zielscheibe mit deutscher Flagge schoss. Teil dieses Hasses bekam auch der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Dominik Kaufner in den Sozialen Medien ab, nachdem der promovierte Historiker auf die unrühmliche Rolle Polens im Umgang mit seinen ethnischen Minderheiten in der Zwischenkriegszeit hinwies.
Das gepflegte Opferbild
Der Blick auf die Geschichte mutet in Polen generell recht einseitig an. Man scheint sich in der Rolle des Opfers gut zu gefallen und wird deshalb auch nicht müde, jene Teile der Geschichte zu betonen, in denen den Polen tatsächlich Unrecht angetan wurde. Dabei handelt es sich allerdings mitnichten um einen polnischen Sonderfall, da im Prinzip jedem Volk auf die ein oder andere Weise Unrecht widerfahren ist – zumindest nach heutigen Maßstäben. Geflissentlich ausgespart wird jedoch gerne, dass Polen in jenen Epochen, in denen es das Heft des Handels selbst in der Hand hielt, nicht anders verfuhr (auch das unterscheidet sie nicht von anderen historischen Akteuren).
Das betrifft etwa jene Zeit, in denen die Polen als dominante Kraft der polnisch-litauischen Personalunion die Ordnungsmacht in Osteuropa waren. Sie besetzten sogar Moskau, wonach die Russen 1618 im Friedensvertrag von Deulino weitreichende Gebiete abtreten mussten. Die Polen stellten nur in einem kleinen Teil dieses Vielvölkerstaates die Mehrheitsbevölkerung.
Machtstreben statt Moral
Aber auch in der Zwischenkriegszeit, auf die sich Dr. Kaufner bezog, bekleckerte sich Polen nicht gerade mit Ruhm. Nicht nur, dass Polen 1920 nur zwei Tage nach dem Vertragsschluss von Suwałki ins benachbarte Litauen einmarschierte und das Gebiet um Wilna besetzte, auf das in ebendiesem Vertrag offiziell von polnischer Seite verzichtet wurde, sondern noch im März 1938 die Litauer mit erneutem Krieg bedrohte, sollten die diplomatischen Beziehungen, die aus Protest gegenüber der polnischen Besetzung der litauischen Hauptstadt eingestellt wurden, nicht wieder aufgenommen werden. 1938 wurde zudem von polnischer Seite opportunistisch das Olsa-Gebiet (Teschen) von der Tschechoslowakei annektiert. Zudem wurden für Polen ungünstige Volksabstimmungsergebnisse ignoriert.
Kaum war Polen also wieder auf der politischen Landkarte, expandierte es, wo sich die Möglichkeit bot. Auch ein Angriff auf das geschwächte Deutschland wurde ernsthaft in Erwägung gezogen. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs war jeder dritte Einwohner Polens kein Pole. Der Umgang mit den Deutschen in jenen Gebieten, die in Versailles Polen zugeschlagen wurde, ist ebenso unrühmlich. Nicht von ungefähr emigrierten bis 1921 an die 500.000 Deutsche aus Posen und Westpreußen ins Deutsche Reich und aufgrund von aggressiver Polonisierung bis zum Kriegsausbruch mindestens eine weitere Million vor allem aus Oberschlesien. Die polnischen Großmachtbestrebungen gingen aber weiter und schwankten dabei stets zwischen Ost- und Westerweiterung.
Geschichtspolitik als Waffe
Schon mit Kriegsende und noch bevor die Pariser Vorortverträge beschlossen wurden, entbrannte der deutsch-polnische Historikerstreit, der für das jeweilige Land eine möglichst günstige Grenzziehung erhoffte. Roman Dmowski vertrat dabei die polnischen Forderungen in Form von Gebietsansprüchen bei den Verhandlungen in Versailles. Schon Dmowski argumentierte die polnischen Forderungen mit der „Wiedergutmachung historischen Unrechts“. Er forderte dabei Gebiete, die nie in polnischem Besitz waren, und verwies auf Wiedergutmachung der polnischen Teilungen. Weiters argumentierte er, der polnische Nationalstaat sei das historische Erbe der der deutschen Ostsiedlung zum Opfer gefallenen westslawischen Stämme. Daraus wurde die „Ausrottungstheorie“ abgeleitet, die den Deutschen vorwarf, ebenjene westslawischen Stämme, gewaltsam germanisiert zu haben.
Die polnischen Historiker jener Zeit versuchten zudem eine Einheit der lechitischen Völker zu kreieren. Die lechischen Stämme stellen eine Untergruppe der Westslawen dar, zu welchen die Pommoranen und Slowinzen, Polaben, slawische Schlesier, Elb- und Ostslawen sowie Kaschuben und Sorben gezählt wurden. Darauf aufbauend forderte Polen mit Rückgriff auf das Mittelalter, bevor die deutsche Ostsiedlung begann, die Elbgrenze. Entsprechend enttäuscht war man mit der Grenzziehung der Entente-Mächte 1919, obwohl Polen zu den großen Gewinnern zählte und vorher politisch auf der Karte gar nicht existierte.
Angemerkt sei, dass es ähnliche Forderungen von deutscher Seite in die andere Richtung gab. Mit der sogenannten Urgermanentheorie leitete man Ansprüche im Osten ab, indem eine historische Kontinuität von den altertümlichen Germanen, die während der Völkerwanderung nach Westen zogen, zu den Deutschen, welche fast eintausend Jahre später in der deutschen Ostsiedlung wieder in den Osten zurückkehrten, besteht. Somit kehrten nach dieser Auffassung die Germanen in Gestalt der Deutschen in ihre ursprünglichen Stammesgebiete zurück. Die Ansprüche konnten so beliebig bis hin zur Vor-Völkerwanderungszeit erweitert werden, was in den nationalsozialistischen Ansprüchen unter dem Schlagwort „Lebensraum im Osten“, der deutsche Siedlungsgebiete bis zum Ural forderte, gipfelte. Heute würde niemand ernsthaft eine deutsche Krim verlangen – selbst wenn dort im 3. Jahrhundert Goten siedelten.
Piłsudskis Reichsträume
Mit der autoritären Herrschaft von Marschall Józef Piłsudski ab 1926 wechselte der Fokus des polnischen Großmachtstrebens gen Osten. Piłsudski wollte nicht nach Westen auf Kosten Deutschlands expandieren, sondern ostwärts auf Kosten der Sowjetunion. Er kämpfte schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts für die polnische Unabhängigkeit und beteiligte sich sogar in St. Petersburg an Vorbereitungen für ein Sprengstoffattentat auf Zar Alexander III., was ihm eine vorübergehende Deportation nach Sibirien bescherte. Seine Sympathien für Russland waren also enden wollend.
Mit dem Versuch des nationalsozialistischen Deutschlands, sich international besser zu positionieren, fand es ausgerechnet in Polen einen Verbündeten für die Anfechtung des Diktatfriedens. Am 26. Jänner 1934 unterzeichneten die beiden Länder deshalb einen zehnjährigen Nichtangriffspakt und planten eine gemeinsame Invasion der Sowjetunion. Dieser sogenannte Hitler-Piłsudski-Pakt sollte es ermöglichen, die Grenzstreitigkeiten auf diplomatischem Weg zu beseitigen. Dabei erhob Hitlerdeutschland Anspruch auf Danzig mit dem Danziger Korridor und forderte eine Grenzkorrektur in Oberschlesien. Das widerstrebte Akteuren wie Roman Baginski, der ein Verfechter der Annexion deutscher Gebiete war. Mit dem antirussischen Piłsudski war aber eine Übereinkunft durchaus realistisch. Das hätte eine polnische Ostverschiebung bedeutet, die den historischen Gegebenheiten mehr entsprochen hätte als jene Westverschiebung, die dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs politische Realität wurde.
Vom Intermarium zum Imperium
Piłsudski schwebte die Verwirklichung des Intermarium vor, was de facto eine territoriale Wiederherstellung der polnisch-litauischen Union gewesen wäre. Intermarium bezieht sich dabei auf das Gebiet zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, wobei das Konzept von Piłsudski später sogar erweitert wurde und den Einschluss Rumäniens, Ungarns, der Tschechoslowakei sowie des SHS-Staates erwog.
Man stelle sich vor, diverse Gruppen in Österreich forderten in ähnlicher Weise eine territoriale Wiederherstellung des habsburgischen Vielvölkerstaates. Aus manchen polnischen Kreisen scheint man heute bemüht zu sein, beide Expansionsfantasien verwirklichen zu wollen, also die polnische Hegemonialstellung im Osten, was im Übrigen neben Litauen und Weißrussland auch die heutige Ukraine miteinschließen würde, und die Rückgängigmachung der Germanisierung der Slawen östlich der Elbe: Ein Polen von der Elbe bis an den Don also. Ebenso schwanken so manche politischen Akteure in Polen zwischen antirussischen und antideutschen Ressentiments, was historisch nachvollziehbar ist, aber dem Versuch der friedlichen Völkerverständigung völlig zuwiderläuft.
Unrecht als Rache
Gleichzeitig reagieren ebendiese polnischen Akteure äußerst aggressiv, wenn man sie auf das große Leid der Deutschen ab Januar 1945 hinweist. Da wird dann argumentiert, dass die Vertreibung der 14 Millionen Ostdeutschen aus ihrer angestammten Heimat sowie die Ermordung von zwei Millionen ebendieser „berechtigte Rache“ gewesen sei. So als ob ein Unrecht ein anderes Unrecht rechtfertigen würde.
Vor allem aus rechter Sicht ist es äußerst bedauerlich, dass solch ein Denken einer engeren Kooperation im Weg steht. Gerade Polen bzw. die PiS fällt hier immer wieder negativ auf und verhindert etwa auf EU-Ebene die Schaffung einer gesamtrechten Fraktion, die bereits zweitstärkste Kraft in Brüssel wäre. Wobei sich hier auch etwa die Franzosen bzw. das Rassemblement National einen Ruck geben müssten. Auch sie verhindern mit ihren Vorbehalten gegen die deutsche AfD die Schaffung einer solchen Großfraktion. Es scheint eine historische Kontinuität zu sein, dass Polen und Franzosen die Abneigung gegen Deutsche eint. War doch Frankreich immer der größte Verbündete Polens, wenn es darum ging, Deutschland klein zu halten. Darauf baut man keine nachhaltige Völkerverständigung und gleichberechtigte Partnerschaft im Sinne des Konzepts eines Europas der souveränen Vaterländer auf, die wir Europäer dringend benötigen, um die notwendige Wende einzuläuten.
Polens blinde Flecken: Wie Warschau seine eigene Vergangenheit verdrängt
Mit Bismarck gegen Bosak? – Eine Entgegnung auf die Thesen von Dominik Kaufner
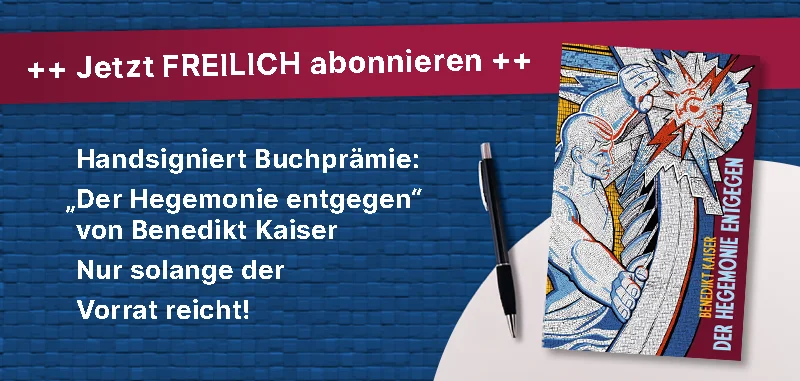
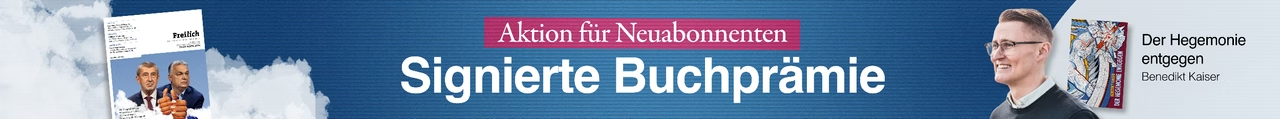


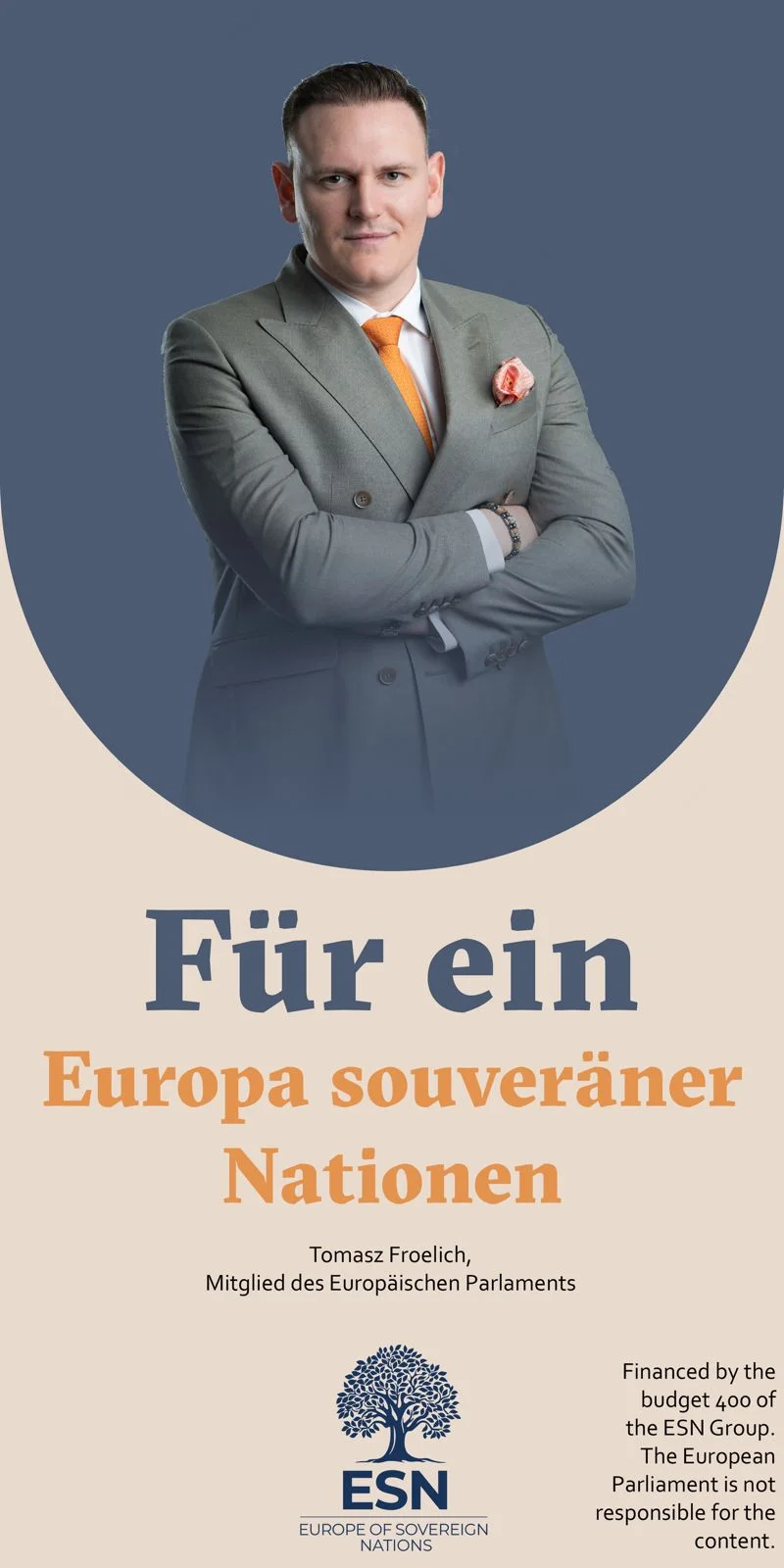

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!