Zunächst möchte ich mich bei der Redaktion von FREILICH bedanken, dass sie mir als Vertreterin des Bundes der Polen in Deutschland ermöglicht, zu den abenteuerlichen geschichtspolitischen Thesen von Herrn Kaufner in seiner Antwort an den stellvertretenden Sejm-Marschall Krzysztof Bosak Stellung zu nehmen.
Im Bund der Polen in Deutschland schätzen wir die offene Debatte über die deutsch-polnische Geschichte und begrüßen jede ehrliche Diskussion über unsere gemeinsame Vergangenheit. Damit eine solche Debatte jedoch zur Völkerverständigung beitragen kann, muss auf beiden Seiten der gute Wille zur Verständigung erkennbar sein.
Diesen guten Willen hat Herr Kaufner in seinem Kommentar leider vermissen lassen. Ich hoffe, dass diese Haltung nicht die Mehrheit der Mitglieder der Alternative für Deutschland widerspiegelt. Diese Hoffnung schöpfe ich aus meiner Teilnahme an einer Veranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion mit Prof. Andrzej Nowak über das geplante Deutsch-Polnische Haus – ein Projekt der Bundesregierung –, die in Polen auf ein insgesamt sehr positives Medienecho gestoßen ist.
Verständigung beginnt mit Respekt
Umso irritierender ist es, dass Herr Kaufner nun den stellvertretenden Sejm-Marschall persönlich angreift, indem er ihm „billige Stimmungsmache“ vorwirft und ihn als „pseudo-rechten“ und „pseudo-konservativen“ Abgeordneten beleidigt. Herr Bosak hatte in seinem Beitrag lediglich historische Fakten über die gezielte Eliminierung der polnischen Eliten durch das nationalsozialistische Deutschland dargestellt. Herr Kaufner vergreift sich in einem Maße im Ton, dass man an seinem guten Willen zur deutsch-polnischen Verständigung zweifeln muss.
Besonders ehrenrührig und dreist ist der Vorwurf, die Zweite Polnische Republik habe seit 1918 einen Völkermord an den Deutschen geplant. Kaufner zitiert hierbei den Historiker Stefan Scheil: „Im Osten begann 1918 die erste Phase des Völkermords, der Ostdeutschland nach 1945 schließlich vernichten sollte.“ Solche Aussagen von einem Gymnasiallehrer für Geschichte zu lesen, entsetzen mich und offenbaren eine tiefe Unkenntnis der deutsch-polnischen Geschichte. Sie stellen eine völlige Verdrehung von Ursache und Wirkung der historischen Ereignisse dar. Dies zeigt zugleich, wie notwendig eine feste Verankerung der deutsch-polnischen Geschichte im deutschen Schulwesen wäre.
Im Folgenden beschränke ich mich auf die Zeit von 1871 bis 1939, um an konkreten Beispielen zu zeigen, dass die schwierige Lage der deutschen Minderheit in der Zweiten Polnischen Republik (1918–1939) eine Folge der antipolnischen und brutalen Germanisierungspolitik Preußens (1871–1918), der revisionistischen Politik Gustav Stresemanns in der Weimarer Republik (1918–1933) und schließlich der ambivalenten Haltung der NS-Zeit war.
Von Bismarcks Kulturkampf bis zur „Hakata“
Es ist wichtig zu betonen, dass Preußen, nicht „Deutschland“ im heutigen Sinne, die Hauptrolle bei den Teilungen Polens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spielte – und dadurch erst zur europäischen Großmacht aufstieg. Die Gebiete Großpolen (Provinz Posen), Königlich Preußen bzw. Polnisch-Preußen kamen unter die Herrschaft des Hauses Hohenzollern. Seitdem war die Niederhaltung Polens und des polnischen Volkes Staatsräson. Bismarck schrieb 1861 in einem Brief an seine Schwester: „Haut doch die Polen, dass sie am Leben verzagen; ich habe alles Mitgefühl für ihre Lage, aber wir können, wenn wir bestehen wollen, nichts anderes tun, als sie ausrotten.“
Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 unter preußischer Führung begann der Kulturkampf gegen die Katholiken – insbesondere gegen die in Preußen lebenden Polen. Zum Symbol der antipolnischen Politik wurde der 1894 gegründete Deutsche Ostmarkenverein. Ziel war die vollständige Germanisierung der Provinzen Posen, Westpreußen und Schlesien, wo viele autochthone Polen – häufig in der Mehrheit – lebten. Die Polen nannten diesen Verein „Hakata“, nach den Anfangsbuchstaben der Gründer: Hansemann, Kennemann und Tiedemann. Die Hakata führte staatlich unterstützte Hasskampagnen wie „Kauf nicht beim Polen“ oder „Sprich nicht Polnisch“.
Durch gezielten Landaufkauf, Diskriminierung im öffentlichen Dienst und das Verbot polnischen Sprachunterrichts sollten Polen verdrängt werden. Schulen und Pfarreien wurden geschlossen, Tausende Familien vertrieben. Symbolisch war der Kinderstreik von Września (1901), als polnische Kinder den Deutschunterricht verweigerten und dafür brutal bestraft wurden.
Deutschlands schwieriger Blick nach Osten
Diese Erfahrungen stärkten das polnische Nationalbewusstsein – und ja, auch den Groll gegenüber Preußen. Daher wurden nach 1918 Maßnahmen ergriffen, um die Folgen der Germanisierungspolitik rückgängig zu machen. Man griff dabei zu denselben Instrumenten, die zuvor Preußen gegen die Polen angewendet hatte. Vor diesem Hintergrund Polen als Aggressor darzustellen, ist geradezu absurd. Wenn Herr Kaufner dies als „Völkermord“ bezeichnet, müsste er konsequenterweise auch Bismarcks Politik als „Völkermord an den Polen“ anerkennen.
Während der Weimarer Republik wurde die Grenze zu Polen von allen deutschen Parteien nicht anerkannt; unter Stresemann betrieb man eine konsequent revisionistische Politik. Polen wurde abfällig als „Saisonstaat“ bezeichnet, und man versuchte, es durch den Zollkrieg von 1925 bis 1934 durch wirtschaftlichen Druck zur Grenzrevision zu zwingen. Wenn Herr Kaufner die Lage der Deutschen in der Zweiten Republik beklagt, sollte er zugleich die Situation der Polen im Deutschen Reich bedenken – eine Perspektive, die in der deutschen Politik bis heute selten eingenommen wird.
Zwischen 1918 und 1939 wurden polnische Schulen geschlossen, Lehrer schikaniert oder versetzt, polnischen Organisationen die Registrierung verweigert. In der deutschen Presse war von der „polnischen Bedrohung des Reiches“ die Rede. 1932 untersagte ein deutsches Gericht die Verwendung des Symbols des Weißen Adlers – Emblem des Bundes der Polen in Deutschland – mit der Begründung, es gefährde die „deutsche nationale Einheit“. Daraufhin entstand 1933 das Rodło-Zeichen, das bis heute Symbol der Polen in Deutschland ist.
Im August 1939, noch vor dem deutschen Überfall auf Polen, wurden bereits Massenverhaftungen polnischer Aktivisten durchgeführt. Viele wurden in den Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen ermordet. Dies war kein spontaner Kriegsakt, sondern das Ergebnis einer lange vorbereiteten Vernichtungspolitik: Alle polnischen Schulen wurden geschlossen, das Vermögen des Bundes der Polen wurde beschlagnahmt, die Nutzung der polnischen Sprache wurde verboten und die Presse wurde zensiert.
Deutsch und Polnisch – zwei Sprachen, ein gemeinsames Gedächtnis
Herr Kaufner hat vollkommen recht, wenn er darauf hinweist, dass beleidigende oder feindselige Gesten einzelner polnischer Politiker gegenüber Deutschland inakzeptabel sind. Doch es ist unredlich, wenn er gleichzeitig die Provokationen deutscher Politiker verschweigt und dann auch noch den ungeheuerlichen Vorwurf eines von Polen geplanten Völkermords erhebt – während das nationalsozialistische Deutschland zwischen 1939 und 1945 einen realen, millionenfachen Völkermord an den Polen verübte. Mit solchen Entgleisungen verspielt Herr Kaufner das Vertrauen, das seine Kollegen im Bundestag durch ernsthafte Initiativen und die Veranstaltung mit Prof. Andrzej Nowak in Polen mühsam aufgebaut haben.
Wer die Geschichte interpretiert, trägt Verantwortung. Wahrheit lässt sich nur erkennen, wenn man die Perspektiven und Erfahrungen beider Seiten berücksichtigt – nicht, wenn man eine Seite ignoriert oder abwertet. Eine echte Verständigung zwischen Deutschen und Polen kann nur gelingen, wenn wir einander zuhören, voneinander lernen und die Sprache des anderen verstehen.
Die Förderung der polnischen Sprache in Deutschland und der deutschen Sprache in Polen würde dazu beitragen, historische Quellen beider Seiten im Original lesen, vergleichen und besser einordnen zu können. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn sich Politiker – auch Herr Kaufner – künftig stärker für diese Art des gegenseitigen Verstehens einsetzen würden.
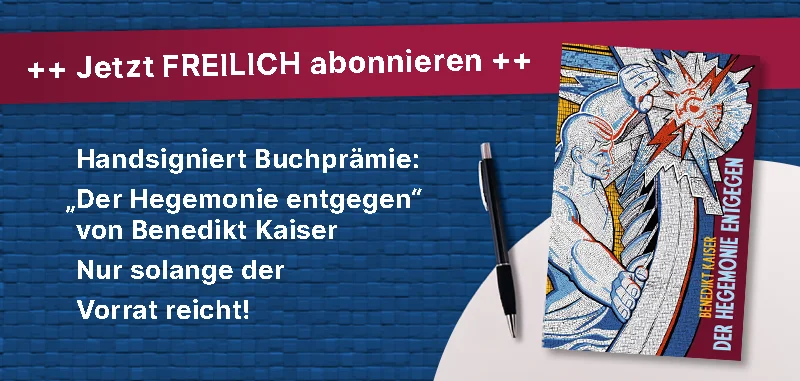
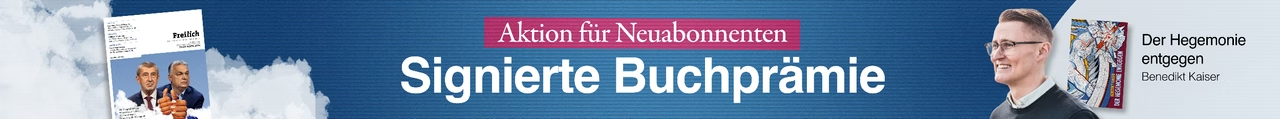

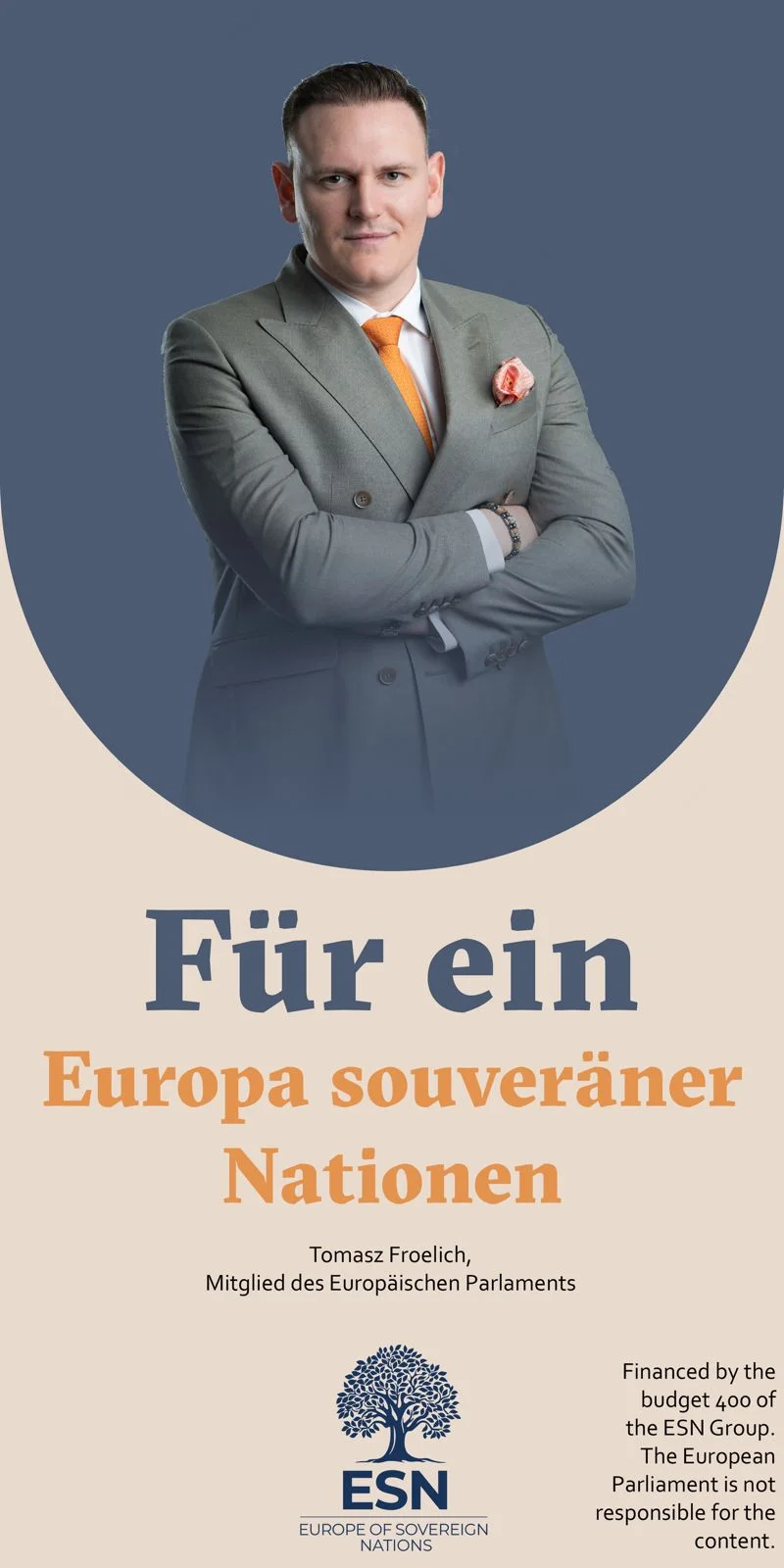

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!