Berlin. – Zehn Jahre nach der großen Migrationswelle von 2015 sind die meisten Migranten in Deutschland berufstätig. Laut Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) liegt die Beschäftigungsquote bei 64 Prozent. Zählt man Selbstständige hinzu, ergibt sich eine Erwerbstätigenquote von 70 Prozent, wie der MDR berichtet.
Unterschiedliche Integration in den Bundesländern
Die Studie zeigt deutliche regionale Unterschiede. So sind in Baden-Württemberg 66 Prozent der im Jahr 2015 Eingereisten erwerbstätig, in Bayern sind es 58 Prozent. Deutlich geringer fällt die Quote in den ostdeutschen Ländern aus: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt erreichen 49 Prozent, Sachsen und Thüringen etwa 50 Prozent.
Die Autoren der Studie verweisen darauf, dass die Integration dort besser gelingt, wo die Wirtschaft stark ist und die Arbeitslosigkeit niedrig ist. In der Studie heißt es: „Umgekehrt fallen in Bundesländern mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit – wie den meisten ostdeutschen Ländern – auch die Beschäftigungsquoten der Geflüchteten geringer aus.“ Auch die Einkommen folgen diesem Muster: In wirtschaftsstarken Regionen verdienen Eingewanderte mehr.
Verdienste nur knapp über der Niedriglohnschwelle
Insgesamt erzielen Zugewanderte deutlich geringere Löhne als andere Beschäftigte. So lag das mittlere Einkommen in Vollzeit im Jahr 2024 bei 70 Prozent des Durchschnitts aller Vollzeitkräfte und damit nur knapp oberhalb der Niedriglohnschwelle von 66 Prozent. „Allerdings sind viele Geflüchtete noch jung und stehen am Anfang ihrer Erwerbsbiografie“, schreiben die Autoren.
Laut IAB sind Eingewanderte häufig in Engpass- und systemrelevanten Berufen tätig, beispielsweise im Gesundheitswesen und in der Logistik. Eine Tätigkeit gilt als systemrelevant, wenn sie „für die Aufrechterhaltung zentraler Infrastrukturaufgaben“ unverzichtbar ist.
Starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen
Das Gefälle zwischen den Geschlechtern bleibt besonders groß. So sind 76 Prozent der im Jahr 2015 nach Deutschland gekommenen Männer erwerbstätig. Frauen hingegen erreichen nur 35 Prozent und liegen damit deutlich unter dem Wert der weiblichen Bevölkerung von 69 Prozent. Viele von ihnen arbeiten zudem in Teilzeit.
„Das größte Potenzial für mehr Erwerbstätigkeit unter Geflüchteten liegt bei den Frauen. Der teils unzureichende Zugang zu Kinderbetreuung bleibt jedoch eine zentrale Hürde für ihre Integration in den Arbeitsmarkt“, erklärte Yuliya Kosyakova, Leiterin des Forschungsbereichs des IAB. Während die Erwerbsquote bei Müttern mit Kindern unter sechs Jahren bei 21 Prozent liegt, beträgt sie bei Frauen ohne Kinder 40 Prozent.
Laut der Studie gibt es weitere Gründe: geringere Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse, eine schlechtere gesundheitliche Verfassung sowie ein späterer Einstieg in Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen.
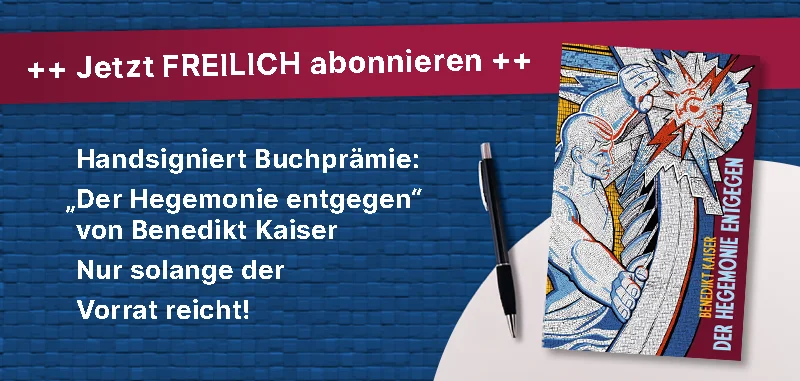
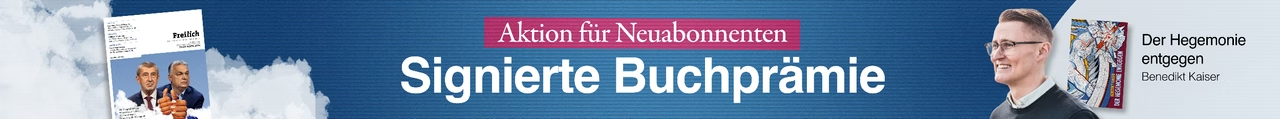

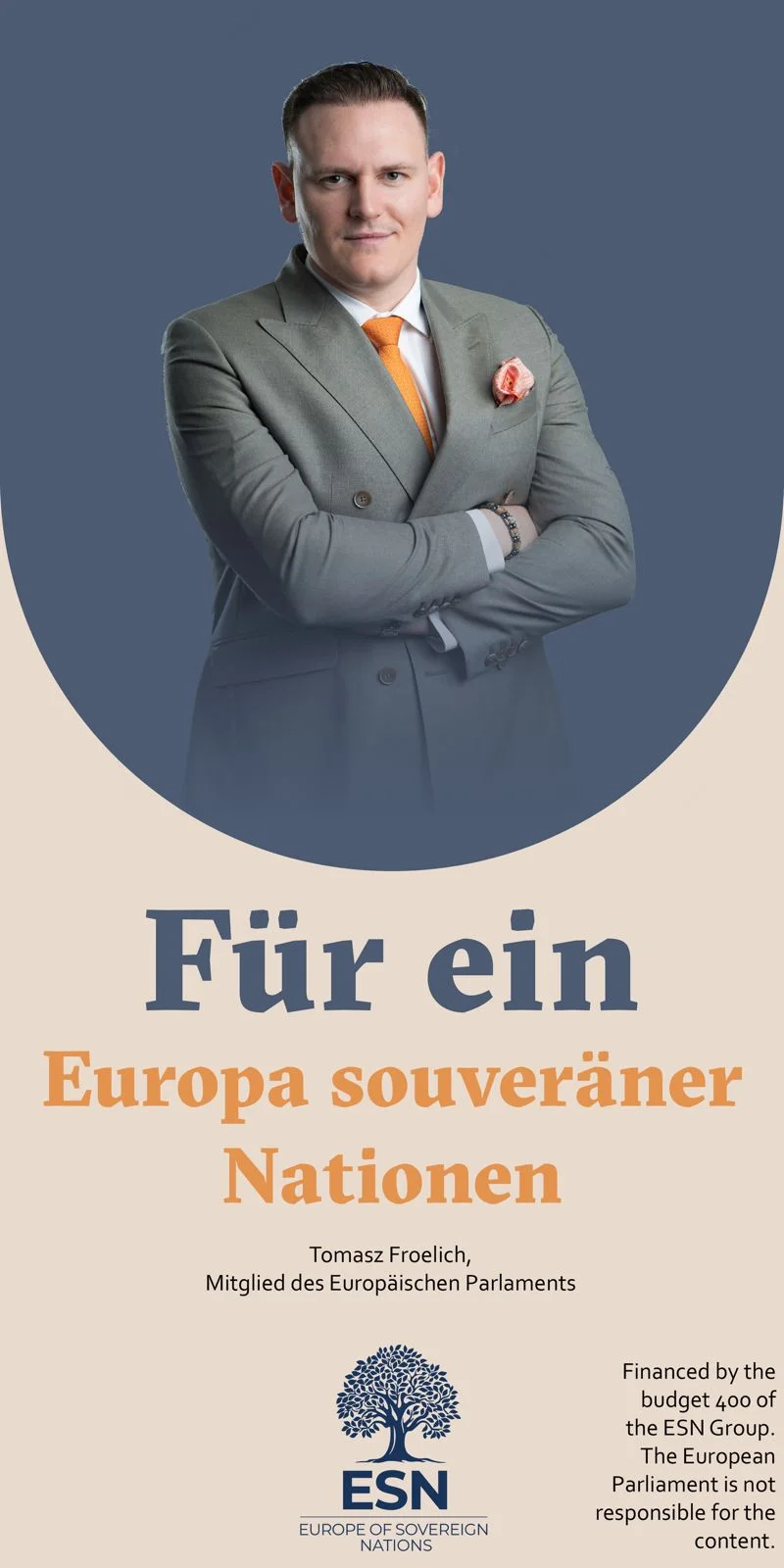

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!