Die gegenwärtige Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht berührt weit mehr als nur eine organisatorische oder sicherheitspolitische Frage. Sie berührt das Selbstverständnis eines Staates, der sich seiner eigenen Legitimität nicht mehr sicher ist – und sie wirft ein Schlaglicht auf den tiefgreifenden Wandel des Verhältnisses zwischen Staat, Individuum und Gesellschaft im Zeitalter geopolitischer Neuorientierungen.
Historisch betrachtet war die Wehrpflicht nie bloß ein militärisches Instrument, sondern immer auch ein Akt symbolischer Machtausübung. Seit der französischen Revolution galt die Levée en masse als Ausdruck nationaler Selbstbehauptung – als Moment, in dem das „Volk in Waffen“ zur Verkörperung der Souveränität wurde. Auch im Deutschen Kaiserreich und später in der Bundesrepublik war die Wehrpflicht stets ein politisches Ritual: Sie disziplinierte nicht nur Körper, sondern formte zugleich politische Subjekte, die im Sinne staatlicher Ordnungsideale funktionierten – die Integration des Lebens selbst in den Machtmechanismus des Staates.
Doch jene Idee des wehrhaften Bürgers, der aus Einsicht und Pflichtbewusstsein handelt, ist in der spätmodernen Gesellschaft längst erodiert. Der Individualismus der Gegenwart, der Verlust gemeinsamer politischer Narrative und die zunehmende Entfremdung zwischen Regierung und Regierten haben die symbolische Basis dieser Institution zerstört. Insofern ist die Diskussion über eine „Wiedereinführung“ der Wehrpflicht nicht Zeichen von Stärke, sondern ein Symptom von Schwäche: ein Versuch, durch den Rückgriff auf alte Rituale jene Bindungskraft zu simulieren, die man politisch und kulturell längst verloren hat.
Strukturen ohne Substanz
Das unumgehbare Vorzeichen in dieser Debatte ist ohnehin: Die Strukturen, auf die eine Wehrpflicht überhaupt aufbauen könnte, existieren längst nicht mehr. Kasernen wurden geschlossen, Ausbildungskapazitäten abgebaut, Personal reduziert, Gerät verkauft oder verschenkt. Die gesamte Logistik einer Massenarmee – von der Unterbringung über die Versorgung bis zur Ausbildung – wurde seit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 systematisch zurückgefahren. Die Bundeswehr ist heute ein personell ausgedünnter Apparat, der auf freiwillige Berufssoldaten zugeschnitten ist. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht unter diesen Bedingungen wäre nicht nur organisatorisch, sondern konzeptionell absurd: Man ruft nach Pflicht, wo keine Struktur ist, nach Disziplin, wo kein System mehr funktioniert.
Der nunmehr erfolgte Vorschlag eines Los-Systems, das per Zufallsprinzip über Lebenswege entscheidet, offenbart die ganze Ratlosigkeit dieses Projekts. Die Gleichheit, auf die sich das republikanische Ideal einst berief, wird hier durch administrative Willkür ersetzt. Es ist die Logik einer Bürokratie, die nicht mehr regiert, sondern nur noch verwaltet. Pflichterfüllung ohne Überzeugung, Gehorsam ohne Sinn.
Im Schatten der Vormacht
Noch problematischer ist der geopolitische Kontext, in dem diese Debatte geführt wird. Die Forderung nach einer neuen Wehrpflicht fällt in eine Zeit, in der europäische Außenpolitik weiterhin im Schatten fremder Sicherheitsinteressen steht, in der die Rhetorik von „Verantwortung“ und „Abschreckung“ zur moralischen Kulisse einer neuen Blockbildung wird. In diesem Rahmen erscheint die Wehrpflicht weniger als Ausdruck nationaler Souveränität, sondern als Teil eines hegemonialen Narrativs, das den Bürger zum Werkzeug globaler Machtstrategien degradiert.
Wer heute von der „Pflicht zum Dienst am Vaterland“ spricht, muss sich fragen lassen, welches Vaterland er dabei überhaupt meint. Ein Staat, der wirtschaftlich, technologisch und sicherheitspolitisch in dichte internationale Abhängigkeiten – gegenüber den USA, gegenüber der Ukraine – eingebettet ist, kann seine Bürger kaum mehr zu einer Opferbereitschaft verpflichten, die er selbst politisch nicht einzulösen vermag. Der Appell an die „nationale Verantwortung“ wird zur Ersatzideologie, mit der ein Staat seine strukturelle Ohnmacht kaschiert.
Pflicht ohne Sinn
So entsteht eine paradoxe Situation: Ein Staat, der sich seiner Souveränität rühmt, führt eine Pflicht ein, die nicht seiner Selbstbehauptung dient, sondern der Stabilisierung einer Ordnung, deren Zentrum außerhalb seiner Grenzen liegt. Die Bürger werden zu symbolischen Trägern einer Politik, die sich selbst nicht mehr zu legitimieren vermag. Wir sehen die Gewöhnung an eine semantische Ordnung, in der „Sicherheit“ immer militärisch, „Freiheit“ immer westlich und „Verantwortung“ immer transatlantisch konnotiert ist. Wer in diesem Diskurs „Verteidigung“ sagt, meint in Wahrheit Anbiederung gegenüber fremden Hegemonien.
Natürlich wäre eine allgemeine Dienstpflicht – sozial, ökologisch, zivilgesellschaftlich – denkbar und unter bestimmten Bedingungen sogar wünschenswert. Sie könnte das zerrissene Band zwischen den Generationen erneuern, neue Formen gemeinsamer Erfahrung ermöglichen und Verantwortung als soziale Praxis erlebbar machen. Doch eine militärische Dienstpflicht in einem Staat, der weder politisch souverän noch institutionell funktionsfähig ist, kann keine moralische Ordnung stiften. Sie bleibt ein Versuch, durch Zwang zu kompensieren, was durch Sinn und Legitimität verloren ging.
„Ja“ zur Wehrpflicht – aber nicht unter diesen Bedingungen
Dabei ist eine Wehrpflicht im Allgemeinen für einen souveränen Staat in einer zunehmend multipolaren und von Konflikten heimgesuchten Welt unabdingbar. Doch dafür müssten die Bedingungen grundlegend andere sein. Erstens bräuchte es einen souveränen Staat, der über seine Sicherheitsinteressen selbst bestimmt, statt sie aus transatlantischen Doktrinen zu übernehmen. Nur wer aus eigenem Willen verteidigt, kann moralisch legitim zum Dienst verpflichten. Zweitens müsste die Infrastruktur – Kasernen, Ausbildungssysteme, Ausrüstung, Verwaltung – wiederaufgebaut und modernisiert werden. Pflicht kann nur dort gelten, wo auch die organisatorische Realität existiert, sie sinnvoll zu erfüllen. Drittens bedürfte es einer neuen politischen und gesellschaftlichen Legitimation, die über Angst, Bündnistreue oder moralische Kampfrhetorik hinausgeht. Eine Wehrpflicht darf nicht auf Propaganda, sondern muss auf Vertrauen gründen – auf die Überzeugung, dass der Staat, dem man dient, tatsächlich das eigene Gemeinwohl schützt.
Die Diskussion über die Wehrpflicht ist daher kein Streit über Rekrutierungszahlen, sondern über die politische Seele der Bundesrepublik. Solange der Staat nicht fähig ist, seine Macht im Interesse der eigenen Bürger und nicht im Schatten fremder Hegemonien auszuüben, bleibt jede Form von Dienstpflicht ein autoritäres Experiment im Gewand freiheitlich-demokratischer Tugend. Die wahre Frage lautet also nicht, ob junge Menschen wieder dienen sollen – sondern ob der Staat, dem sie dienen sollen, noch ihnen gehört.
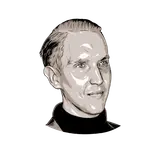

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!