Europa hat sich politisch verändert. Die einst stabilen Nachkriegsparteienlandschaften sind zerfallen, neue politische Kräfte sind entstanden, und stabile Mehrheiten sind zur Seltenheit geworden. Während Deutschland noch immer am Bild einer politischen Ordnung festhält, die es so längst nicht mehr gibt, haben andere Länder längst gelernt, mit der neuen Pluralität pragmatisch umzugehen. In Schweden, Dänemark, den Niederlanden oder Norwegen hat sich ein Regierungsmodell durchgesetzt, das demokratischer und zeitgemäßer ist als jede künstliche Großkoalition: die Minderheitsregierung. Und gerade dort, wo dieses Modell funktioniert, spielen rechte Parteien eine entscheidende Rolle – nicht als Störfaktor, sondern als stabile, verantwortungsvolle Stützpfeiler bürgerlicher Regierungen.
Schweden als Vorbild europäischer Normalität
Schweden ist dafür das wohl eindrucksvollste Beispiel. Dort regiert seit 2022 ein bürgerliches Dreierbündnis ohne eigene Mehrheit – gestützt durch ein formalisiertes Abkommen mit den Schwedendemokraten. Diese Partei, die über Jahre isoliert wurde, ist heute nicht nur inhaltlich prägend, sondern institutionell eingebunden, ohne selbst Minister zu stellen. Die Stabilität des sogenannten Tidö-Abkommens zeigt: Wenn man politische Realität akzeptiert und parlamentarisch übersetzt, entsteht Ordnung, nicht Chaos. Schweden hat dadurch die vielleicht transparenteste Minderheitsregierung Europas – und sie funktioniert.
In Dänemark ist diese Form der Regierungsbildung beinahe Tradition. Venstre-Regierungen existierten über Jahre als Minderheitsregierungen, getragen von der Dänischen Volkspartei. Dabei war die DF keine Randgestalt, sondern ein klarer politischer Faktor, der migrations- und integrationspolitische Leitlinien der Mitte maßgeblich geprägt hat. Das Modell war nicht nur stabil, sondern demokratisch vorbildlich: Es machte politische Verantwortlichkeit sichtbarer, nicht geringer.
Abkommen in Dänemark und den Niederlanden
Auch die Niederlande haben gezeigt, wie ein solches Modell funktionieren kann. Als 2010 die Minderheitsregierung Rutte I gebildet wurde, war allen offen bewusst, dass sie nur durch die parlamentarische Unterstützung der PVV Geert Wilders’ bestehen konnte. Diese Stützfunktion war vertraglich definiert, transparent und politisch sauber. Als die PVV später ihre Unterstützung entzog, wurde das Parlament gefragt – und es kam zu Neuwahlen. Genau so funktioniert eine reife Demokratie: offen, kontrolliert und ohne moralische Dramatisierung.
Norwegen wiederum integrierte die Fortschrittspartei in Regierungsverantwortung, zunächst als Koalitionspartner, später in einer Minderheitskonstellation. Auch dort zeigte sich: Die Einbindung rechter Kräfte führt nicht zur Destabilisierung, sondern zur Normalisierung des politischen Spektrums. Minderheitsregierungen werden dadurch nicht schwächer, sondern professioneller. Europa hat begriffen, dass der Ausschluss neuer politischer Kräfte ein größeres Risiko darstellt als ihre kontrollierte Integration.
Deutschlands politischer Sonderweg
Deutschland bildet dazu den schärfsten Kontrast. Anstatt auf politische Fragmentierung mit parlamentarischer Offenheit zu reagieren, hat sich hier ein Abwehrkartell herausgebildet, das sich in erster Linie über seine Distanz zur AfD definiert. Die Brandmauer ist keine politische Linie, sondern ein Ersatz für politische Substanz. Dabei sitzt die noch regierende CDU, die zusammen mit der Loser-Partei SPD in der ungeliebten Koalition vor sich hergetrieben wird, wie gefangen zwischen Parteiräten, Medien, Funktionärslogiken und dem eigenen historischen Selbstverständnis. Ihr größtes Dilemma besteht darin, dass sie wohl irgendwie weiß, was ihre Wähler wollen, aber nicht wagt, politisch zu handeln. Das nennt man kognitive Dissonanz. Die Union sieht die Entwicklungen in Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen – und verweigert sich exakt diesen Modellen, die ihr einen möglichen Exit aus ihrem ureigenen Dilemma ermöglichen würde. Damit blockiert sie nicht die AfD, sondern nur sich selbst.
Hinzu kommt eine gefährliche Entwicklung: Statt die AfD politisch zu stellen, wächst der Impuls, die Opposition über juristische oder administrative Mittel zu beseitigen. Die Eliminierung der Opposition ist jedoch keine demokratische Lösung – sie ist das Eingeständnis eines Systems, das seine politische Gestaltungskraft verloren, sich selbst irgendwie überlebt hat. Opposition ist kein Unfall der Demokratie, sondern ihre zentrale Funktionsbedingung. Wer sie bekämpft statt mit ihr zu konkurrieren, verlässt den Boden der parlamentarisch-repräsentativen Ordnung.
Gerade deshalb wäre ein offenes Minderheitsmodell, wie es ganz Europa längst praktiziert, in Deutschland nicht nur möglich, sondern demokratisch geboten. Es würde die politische Landschaft entkrampfen, Debatten öffnen und das Parlament in einen Raum politischer Normalität im Sinne agonaler Demokratie zurückführen.
Ein realistischer Ausweg
Als AfD sind wir längst bereit, Verantwortung zu übernehmen – in jeder Konstellation. Ob als parlamentarische Stütze eines bürgerlichen Minderheitsmodells, als Partner in einer Regierung oder als führende Kraft einer eigenen Mehrheit: Die AfD ist als Volkspartei des politischen Realismus darauf vorbereitet, staatliche Vernunft und nationale Interessen wieder zum Maßstab zu machen. Der Hinweis auf absolute Mehrheiten ist dabei keine Drohung, sondern eine demokratietheoretische Beschreibung eines Trends, den viele sehen, aber nur wenige aussprechen wollen.
Es liegt nicht an der AfD, die CDU vor ihrem strategischen Fehler zu schützen. Wenn sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen will, dann ist das ihr Problem, nicht unseres. Man kann niemandem helfen, der nicht sehen will, dass Minderheitsmodelle in Wahrheit ihr einziger Ausweg aus einem selbstverschuldeten Dilemma sind. Die Wähler werden entscheiden müssen, ob Deutschland den in ganz Europa stattfinden politischen Wandel aktiv gestaltet oder von ihm überrollt wird. Die AfD wird in jedem Fall bereitstehen – entschlossen, souverän und handlungsfähig.
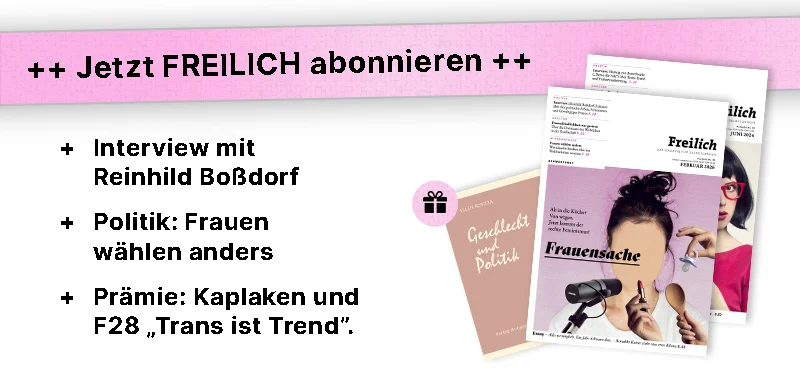


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!