Mainz/München. – Laut einer Untersuchung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Ludwig-Maximilians-Universität München war die Corona-Berichterstattung deutscher Leitmedien „einseitig“ und „regierungsnah“. Die Forscher halten in ihrer Studie fest, dass die Medien eine „eindeutig warnende Haltung“ eingenommen hatten, die man „durchaus als einseitig betrachten kann“, wie das Multipolar-Magazin berichtet. Im Fokus hätten vor allem Politiker von Union und SPD sowie ausgewählte Virologen gestanden, während „Corona-Skeptiker“, Oppositionspolitiker und Betroffene der Maßnahmen kaum zu Wort gekommen seien.
Dabei wurden die TV-Nachrichten Tagesschau (ARD), heute (ZDF), RTL aktuell und ARD Extra zur Corona-Pandemie sowie die Online-Auftritte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, der Welt, der Bild, des Spiegel, des Focus und von t-online zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 30. April 2021 untersucht.
Fokus auf harte Maßnahmen
Die analysierten Formate plädierten, ähnlich wie die Politik, überwiegend für harte Maßnahmen. Zwar seien die Medien laut den Autoren „nicht völlig unkritisch“, doch vor allem sei kritisiert worden, dass Beschlüsse zu spät oder nicht hart genug umgesetzt worden seien. Einseitigkeit sei laut den Forschern nur dann ein Problem, wenn man die Pandemie als eher ungefährlich oder die Maßnahmen als eher übertrieben wahrnehme. Wer hingegen glaube, dass Deutschland durch die Beschränkungen „gut durch die Pandemie gekommen“ sei, könne die mediale Linie als „Ausweis von Rationalität, Wissenschaftsorientierung und hoher Qualität der Berichterstattung“ verstehen.
Folgen der Maßnahmen kaum beleuchtet
Die Studie kommt zudem zu dem Ergebnis, dass negative Folgen nur selten thematisiert wurden: „Die Nöte derjenigen, deren Existenzen durch die Maßnahmen zerstört wurden, oder die dadurch mit psychischen und physischen Problemen zu kämpfen hatten, gerieten zunehmend aus dem medialen Blickfeld.“ Insgesamt sei das Streben nach Sicherheit dominanter gewesen als die Forderung nach Freiheit.
Wenige Stimmen, hohe Medienpräsenz
Die Leitmedien konzentrierten sich laut der Studie auf eine kleine Zahl von Virologen, darunter Christian Drosten. Das spreche „nicht für eine vielfältige Berichterstattung“. Gleichzeitig handele es sich um die „weltweit angesehensten ihres Faches“, weshalb diese Fokussierung auch „rational“ gewesen sei. Später dominierte jedoch nicht mehr der Experte, sondern der SPD-Politiker Karl Lauterbach. Er habe Virologen in der zweiten und dritten Welle „ersetzt“ – nicht aufgrund seiner Expertise, sondern wegen seiner „harten Linie“ in der Corona-Politik, die von vielen Medien „geschätzt“ worden sei.
Wissenschaft oft als Konsens dargestellt
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Unsicherheit wissenschaftlicher Prognosen selten vermittelt und Statistiken kaum eingeordnet wurden. Stattdessen hätten die Medien immer wieder einen Konsens in der Wissenschaft unterstellt. Das Fazit der Studie lautet, dass auch Wissenschaft irren könne, sich ein wissenschaftlicher Konsens unter Umständen erst entwickeln müsse und Prognosen daneben liegen können. Deshalb sollten Journalisten bei der Auswahl von Gesprächspartnern auf deren Fachwissen achten und nicht darauf, was sie „selbst denken oder zum Ausdruck bringen möchten“.
„Einseitig, aber nicht unkritisch“
In einem Interview mit der taz betont Studienautor Marcus Maurer, die Medien seien der Regierung nicht gefolgt, sondern hätten diese mit ihren Forderungen nach strengeren Maßnahmen sogar „vor sich hergetrieben“. Sein Fazit lautet: „Sie haben einseitig berichtet, aber nicht unkritisch.“
Zwar könne er „gut nachvollziehen“, dass Journalisten ein schnelles Ende der Krise herbeischreiben wollten, doch hätten sie auch die Gegenargumente stärker beleuchten müssen: „Menschen kriegen die Probleme ja trotzdem mit und fragen sich: Warum schreibt keiner darüber?“ Maurer warnt vor Vertrauensverlust: Die journalistische Einseitigkeit könnte „kontraproduktiv“ gewesen sein. Mittlerweile vertrauen bis zu 15 Prozent der Bevölkerung den Medien „überhaupt nicht mehr“. Vor der Pandemie lag dieser Wert nur bei rund fünf Prozent.


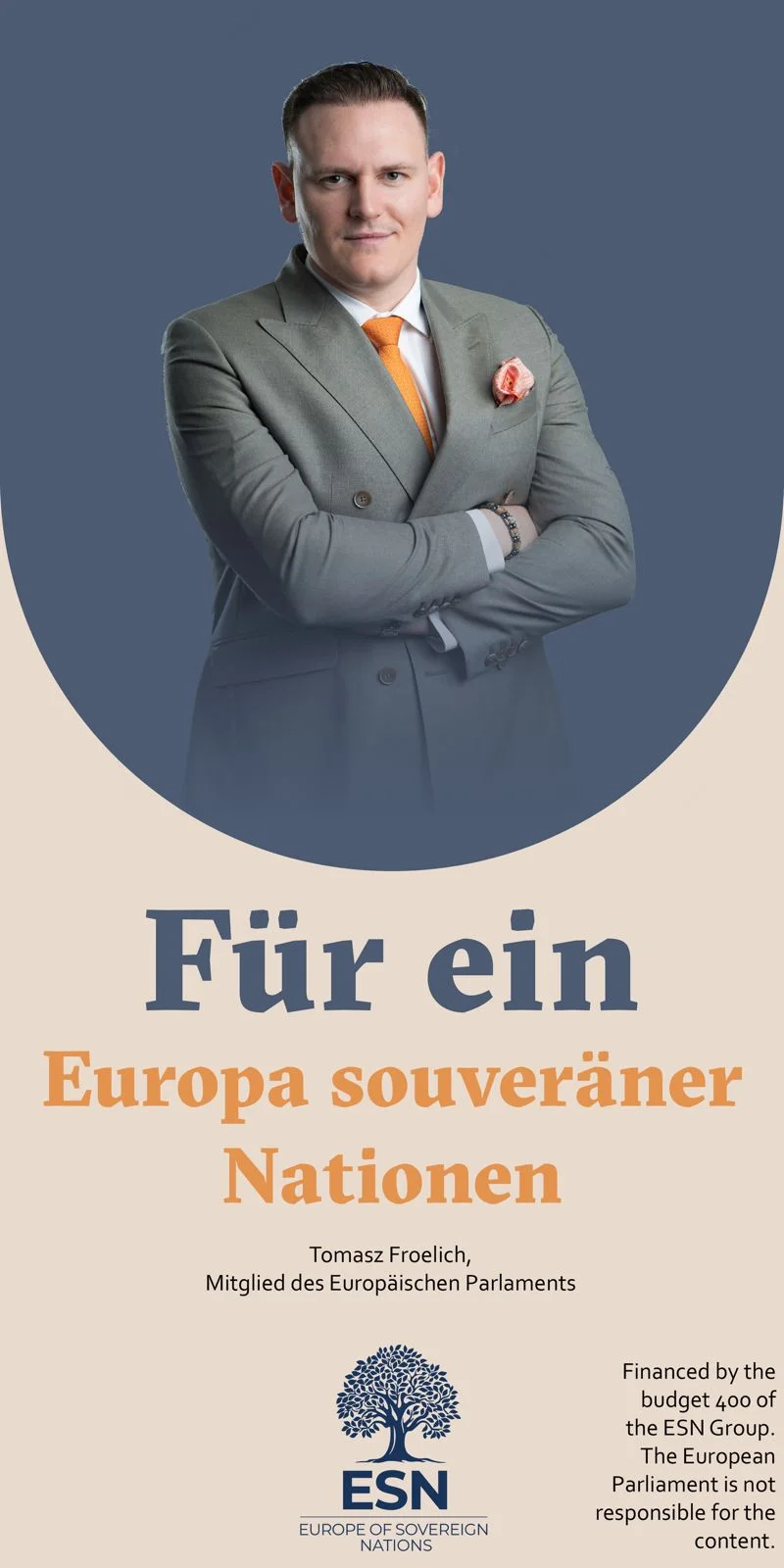

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!