Es liegt etwas im Schwange – dem Eindruck kann sich wohl niemand erwehren, der das gegenwärtige politische Geschehen verfolgt. Wenngleich hinsichtlich etwa der scheinbar von Woche zu Woche in neue Höhen steigenden Umfragewerte der AfD sicherlich einige Skepsis geboten ist, so bleibt es doch erstaunlich, wie rasant die politische Landschaft der Bundesrepublik sich derzeit verändert. Zugegeben: Die aktuelle Regierungskoalition aus trauriger Wankelmütigkeit (CDU) und unverhohlener Streitlust (SPD) bietet gerade die Folie, von welcher sich die AfD entschieden abheben kann. Aber allein die Unfähigkeit und mangelnde Beliebtheit von Merz' Kabinett erklärt wohl kaum die Geschwindigkeit, mit der sich zunehmend klaffende Risse im Eispalast der linken Kulturhegemonie auftun.
Risse im System
Ein besonders exemplarischer solcher Riss ist die erneut aufgekommene Debatte um die Rundfunkgebühr, welche jüngst durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht weiteren Auftrieb erhalten hat. In diesem wurde die Gebühr nur unter dem Aspekt der Einhaltung einer gewissen Meinungsvielfalt für verfassungskonform erklärt. Natürlich ist damit noch nichts gewonnen, aber dass die Zwangsgebühr tatsächlich auf dieser richterlichen Ebene diskutiert wird, ist mehr als beachtlich.
Auch die gescheiterte Kampagne des obersten Kulturkämpfers Jan Böhmermann gegen den YouTuber „Clownswelt“ ist ein deutliches Signal, dass die bewährten Codes und Regeln des linken Establishments dabei sind, ihre Verbindlichkeit zu verlieren. Wo dieser Prozess hinführt – und welche weiteren politischen Optionen sich aus diesem ergeben werden – ist noch unklar. Vermutlich aber wird er sich in bereits nicht allzu ferner Zukunft auch auf die Universitäten ausweiten.
Neue Chancen an den Universitäten
Das im Rahmen dieser Kolumne bereits mehrmals geforderte hochschulpolitische Engagement der AfD hat in diesem Sinne ein brisantes Zeitfenster vor sich. Tatsächlich könnte ein studentischer Ableger der Partei – obgleich an vielen Orten noch undenkbar – schon in kurzer Zeit sehr an Attraktivität gewinnen. Akzeptiert man diese Hypothese, so scheint es naheliegend, dass patriotisch-konservatives Gedankengut sodann von der Universität her endgültig in die gesamte Gesellschaft diffundieren könnte. Das berühmte Vorbild ist dabei die schlechterdings enorm erfolgreiche Kulturrevolution aus dem Jahre 1968, welche in der jungen Bonner Republik vor allem von Studenten getragen wurde. Ich möchte im Folgenden erläutern, warum ich diese Vorstellung für eine historische Engführung halte, die den aktuellen politischen und kulturellen Gegebenheiten nicht gerecht wird.
Die 68er und ihre Voraussetzungen
Selbstverständlich wäre die Erreichung einer den 68er vergleichbaren sozialen und kulturellen Hegemonie wünschenswert. Aber während die umfassenden ideengeschichtlichen, sozialen und politischen Voraussetzungen dieser Kulturrevolution nicht in wenigen Sätzen abzuhandeln sind, so macht schon ein oberflächlicher Abgleich zweier wesentlicher Merkmale der 68er und ihrer Zeit mit den aktuellen Gegebenheiten einsichtig, dass diese in einer grundsätzlich anderen Situation handelten als wir Heutigen.
Zunächst waren die weltanschaulichen Koordinaten der wirkmächtigen Studentenbewegung klar aufgespannt: auf der einen Seite gab es das repressive kapitalistische System, welches es zu überwinden galt, auf der anderen die vor allem auf die Theoriearbeit der Frankfurter Schule zurückgehende Vorstellung einer totalen Emanzipation des Menschen, die sich im Verbund mit liberalen, anarchistischen und marxistischen Versatzstücken zu einer ideologisch vielleicht nicht sehr eindeutigen, aber dennoch politisch äußerst potenten Idee davon verband, wie der schlechte Kapitalismus endgültig zu überwinden sei. Diese grundlegende theoretisch-politische Polarität ermöglichte es den 68ern, innerhalb der Bewegung eine enorme Dynamik zu entwickeln, die sich vor allem aus ihrem starken moralischen Bewusstsein für den Umstand, das Richtige zu tun und zu fordern, ergab. Weiterhin tat die generelle Aufbruchsstimmung nach den Verheerungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der einsetzende wirtschaftliche Aufstieg Westdeutschlands ihr Übriges, um der Studentenbewegung eine seltene optimistische Wucht zu verleihen.
Rechte Politik: nach wie vor unattraktiv
Eine aufkommende AfD-nahe hochschulpolitische Bewegung findet sich demgegenüber heute in beiderlei Hinsicht im Hintertreffen: zunächst ist rechte Politik im 21. Jahrhundert wohl kaum so attraktiv wie der Neomarxismus und der Liberalismus Ende der 1960er-Jahre. Sodann fehlt es in einer Zeit der moralischen Ambiguität und der schwelenden Krisen sowohl an Zuversicht als auch – zumindest unter den Studenten – an einer soliden Masse an überzeugten Leuten, die eine den 68ern vergleichbare Bewegung im strengen Sinne überhaupt erst konstituieren könnte. Für die sinnvolle und naheliegende Forderung einer hochschulpolitischen Agitation von rechts ist diese Einsicht natürlich unerheblich: sie muss stattfinden, so oder so. Aber die Reflexion über die eigenen Bedingungen und Möglichkeiten kann verhindern, dass falsche Erwartungen geweckt und fähige Akteure zu schnell enttäuscht werden.
Vom Ende der liberalen Moderne
Aber selbst wenn solche theoretischen Erwägungen beiseite gelassen würden: ein großer Dammbruch an konservativen Ideen und Wertvorstellungen wird sich nicht in einer den 68ern vergleichbaren Weise vollziehen– womöglich wird es einen solchen überhaupt nie geben. Denn bekanntlich ist – etwas vereinfacht gesagt – der politische Konservatismus keine verführerische, mit den Bedürfnissen und Illusionen des Menschen arbeitende Ideologie, sondern eher eine nüchterne Form der sozio-politischen Realitätsbewältigung, die vor allem von einem skeptischen Menschenbild und einem von diesem ausgehenden pragmatischen Rechnen mit den stets knappen Beständen herrührt.
Die sich ankündigende Krisenzeit wird diese politische Denkform aber so oder so wieder für sich entdecken müssen, denn vieles deutet darauf hin, dass die liberale Moderne mit ihrem singulären Konsumversprechen und historisch ungekannten individuellen Freiheitsgraden in absehbarer Zeit an ihr Ende kommt. Es ist demnach höchste Zeit, diesen zeitgeschichtlichen Prozess auch in Form von neuen studentischen Organisationen zu begleiten und zu prägen. Der originäre Rechte hat hierfür die besten Voraussetzungen: er lebt schließlich sowieso nicht für das, was lediglich möglich oder machbar erscheint – sondern aus dem, was immer gilt.
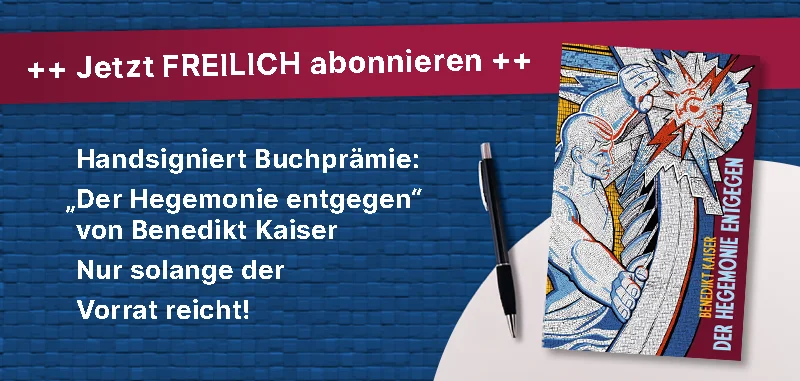
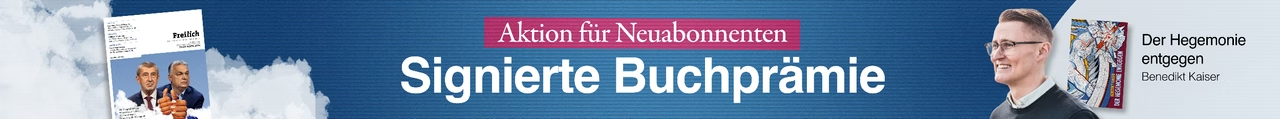

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!