Bern. – Die Schweiz verzeichnet so wenige Geburten wie nie zuvor. Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei 1,29 und damit deutlich unter dem Wert, der für eine stabile Bevölkerungsentwicklung nötig wäre. Auffällig ist jedoch, dass die Zahlen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen variieren. So kommen Schweizerinnen im Durchschnitt auf 1,2 Kinder, Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft auf 1,5. Den Schwellenwert zur Bestandserhaltung von 2,1 Kindern erreichen nur Frauen vom afrikanischen Kontinent.
Kulturelle Prägung als Ursache
Die Frage nach den Ursachen führt zu kulturellen Prägungen, erklärt Demograf Hendrik Budliger: „Ein wichtiger Grund für die Geburtenrate liegt im kulturellen Kontext, in dem jemand aufwächst“, zitiert ihn die Nachrichtenplattform 20min. In manchen Herkunftsländern seien Kinder stärker im Alltag verankert, während in der Schweiz die individuelle Entfaltung im Vordergrund stehe. „Diese kulturellen Unterschiede äußern sich auch in der Geburtenrate hierzulande.” Doch dieser Effekt gleiche sich rasch an. „Ein Mädchen, das mit zehn Jahren oder jünger in die Schweiz kommt, übernimmt meist schon die hiesige Fertilitätsrate.”
Angleichung trotz höherer Werte
Auch wenn ausländische Bevölkerungsgruppen im Durchschnitt noch etwas mehr Kinder bekommen, zeigt der Trend in dieselbe Richtung. „Ob Schweizerin oder Ausländerin – wir leben im gleichen wirtschaftlichen und sozialen System, mit der gleichen Infrastruktur“, betont Budliger. Zu diesem System gehört auch die sogenannte Motherhood Penalty, die in der Schweiz besonders ausgeprägt ist. „Wer Mutter wird, verdient langfristig deutlich weniger, weil viele nur noch Teilzeit arbeiten können. Das macht die Entscheidung für ein Kind schwieriger.”
Kaum Einfluss auf die Bevölkerungsstruktur
Trotz unterschiedlicher Geburtenraten führe dies kaum zu Verschiebungen in der gesellschaftlichen Zusammensetzung, sagt Budliger: „Alle Gruppen haben inzwischen zu tiefe Geburtenraten.” Und er fügt hinzu: „Ob 1,2 oder 1,5 Kinder pro Frau – in beiden Fällen schrumpft die Bevölkerung, nur etwas langsamer.” Selbst höhere Werte in einzelnen Gruppen würden das Gesamtbild kaum verändern, denn „ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist so gering, dass die höhere Geburtenrate kaum Auswirkungen hat“. Zum Vergleich verweist er auf Deutschland während der Migrationskrise: „2015 etwa stieg in Deutschland die Geburtenrate merklich, weil viele Syrerinnen kamen. Deren Geburtenrate lag bei 4, das war in den Daten klar sichtbar.”
Migration als Folge niedriger Geburten
Ein anderer Faktor wird spürbar: Migration. Budliger macht den Zusammenhang deutlich: „Hätten wir mehr Kinder, bräuchten wir weniger Migration. Schon in den 1960er-Jahren wäre kein Wirtschaftswachstum ohne Zuwanderung möglich gewesen“, ekrlärt er. Damit stehe die Schweiz vor einer grundlegenden Weichenstellung. „Wir müssen uns als Land entscheiden, was wir wollen: Wollen wir eine stabile Wirtschaft und einen stabilen Arbeitsmarkt? Dann brauchen wir entweder mehr Kinder oder weiterhin hohe Zuwanderung. Wollen wir weniger Migration, müssen wir akzeptieren, dass der Arbeitsmarkt schrumpft.”
Fehlende Familienpolitik als strukturelles Problem
Budliger sieht deutlichen Nachholbedarf bei der politischen Unterstützung: Es fehle an einer „Lobby für Familien und Kinder“. Viele Herausforderungen würden bislang vertagt, von der Altersvorsorge über den Erhalt der Infrastruktur bis hin zu Fragen des Klimas. Er fordert deshalb Investitionen in bessere Rahmenbedingungen: „Es würde sich für den Staat lohnen, Kitas auszubauen und stärker zu subventionieren.” Zudem müsse eine Familiengründung früher möglich sein, ohne dass dies berufliche Nachteile mit sich bringe. „Wer mit hoher Wahrscheinlichkeit drei Kinder oder mehr will, muss mit 23 mit der Familienplanung anfangen. Das geht nur, wenn Ausbildung und Familiengründung vereinbar sind – sonst werden die Transferleistungen zwischen den Generationen immer größer.“
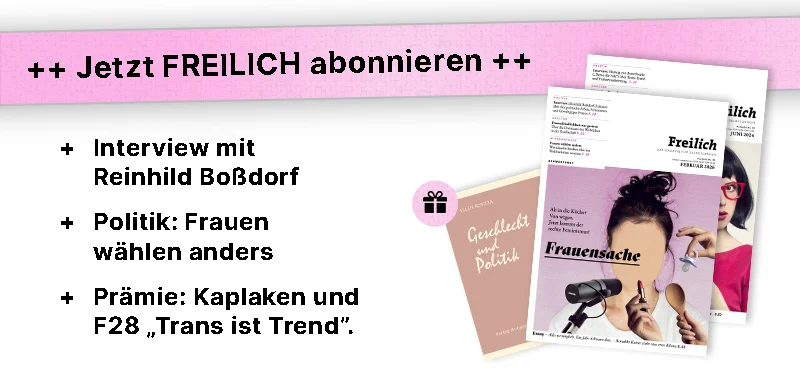


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!