Es ist schon wieder passiert: Die gesamte politische Landschaft Deutschlands diskutiert über eine Aussage des AfD-Ministerpräsidentenkandidaten Ulrich Siegmund für die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in knapp einem Jahr. Man merkt: Der Wahlkampf hat begonnen. Siegmund ist im Podcast des Axel-Springer-Mediums Politico in eine kleine Falle getappt. Er wurde gefragt, wie er auf die Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 blickt. Siegmund bezeichnete sie als „Tiefpunkt unserer Geschichte“. Auf die Nachfrage, ob in dieser Zeit das schlimmste Menschheitsverbrechen begangen wurde, antwortete er: „Das maße ich mir nicht an zu bewerten, weil ich die gesamte Menschheit nicht aufarbeiten kann.“
Bereits vor der Ausstrahlung des Podcasts wurde mit großem Getöse auf die vermeintlich skandalöse Aussage hingewiesen. Der zuständige Politico-Redakteur Gordon Repinski ließ sich nicht die Chance nehmen, sie maximal zu skandalisieren. In einer Vorabmeldung auf dem Webportal Die Welt wies er auf den Podcast mit Siegmund hin und erweckte durch die Auswahl der Zitate den Eindruck, Siegmund wolle den Holocaust relativieren. Hört man sich jedoch das komplette Interview an, zeigt sich, dass der Magdeburger AfD-Politiker differenziert argumentierte und sich diese schwere Frage nicht mit einfachen Floskeln beantworten lässt. Auf solche Graustufen wird im politischen Betrieb der Bundesrepublik seit Jahrzehnten keine Rücksicht mehr genommen.
Der vergessene Schatten des Historikerstreits
Das musste der Berliner Geschichtsprofessor Ernst Nolte in einer großen gesellschaftlichen Auseinandersetzung, dem sogenannten „Historikerstreit“, erfahren. Mit nur wenigen Aufsätzen löste er einen der größten geschichtspolitischen Konflikte aus und wurde dafür aus der akademischen Gesellschaft verbannt. Er wurde gemieden, seine akademischen Veranstaltungen wurden teilweise gestört und sein Auto wurde zerstört. Diese Erfahrungen konnte der Solitär nie wirklich verdauen, auch wenn er danach weiterhin souverän und selbstbewusst mit seinem Schicksal umging.
Der Historikerstreit war eng mit Noltes philosophischer Geschichtsschreibung verbunden, die den Antibolschewismus in den Fokus rückte. Er postulierte einen kausalen Zusammenhang und fragte, ob der Gulag nicht eine „notwendige, wenn nicht hinreichende Bedingung für Auschwitz“ gewesen sei. Noltes Ansatz zielte darauf ab, den Nationalsozialismus in den Kontext des „totalitären Zeitalters“ und des „Weltbürgerkriegs“ zu stellen. Er erkannte, dass der stalinistische Kommunismus in der Tradition der Linken und der Nationalsozialismus in der Tradition der Rechten standen, beide aber eine „realhistorische Plastizität“ und Überschneidungen aufwiesen.
Für seine Kritiker war das in den 1980er-Jahren zu viel. Vor allem Jürgen Habermas polemisierte gegen Nolte. Im Gegensatz zu Noltes Kontextualisierung vertraten die Kritiker die Singularitätsthese. Diese besagt, dass der Holocaust – also der Völkermord an den Juden in Europa – ein unvergleichliches und einzigartiges Verbrechen darstellt. Linke Akteure wie Habermas waren überzeugt, dass erst in den 1980er-Jahren damit begonnen werden müsse, die Geschichte aufzuarbeiten, und lehnten eine von rechten Deutungseliten geforderte Bilanz ab. Die Weizsäcker-Rede von 1985 gilt als Beginn der neuen Holocaust-Forschung.
Die Gegenwart als Wiederholung – in anderer Konstellation
Vierzig Jahre später sieht sich das politische Deutschland nun mit einem Widergänger dieser Debatte konfrontiert, allerdings mit anderen Vorzeichen. Die AfD, die erste seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland politisch bedeutsame Rechtspartei, ist in Mitteldeutschland stärkste Kraft und liegt auch bundesweit in Umfragen mittlerweile vor der Union. Dies ist ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Die damaligen Kritiker sind aus dem akademischen Betrieb verschwunden, ihre Nachfolger beschäftigen sich meist mit typisch „woken“ Politikthemen wie Gender. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der prominenteste Kritiker der Siegmund-Aussage kein akademischer Linker ist, sondern ausgerechnet der als konservative Hoffnung der CDU geltende Carsten Linnemann, der Siegmund jetzt stumpf Holocaust-Leugnung vorwarf, was eine Straftat darstellt. Die Hysterie ist jedoch deutlich geringer als beim Historikerstreit.
Siegmund scheint hier unbewusst als Epigone Noltes aufzutreten. Indem er eine Bewertung ablehnt, die nicht die gesamte Menschheit – und damit implizit andere Gräueltaten, etwa die des Bolschewismus – berücksichtigt, verteidigt er Noltes Versuch, die NS-Verbrechen in einen größeren, gewaltsamen historischen Zusammenhang zu stellen, anstatt sie zu isolieren. Mit anderen Worten: Siegmunds Haltung, ein Urteil abzulehnen, das ihm nicht zusteht, ist eine Kritik an der moralisierenden Geschichtspolitik, die den Historikerstreit stark prägte und die seit jeher von konservativer und rechter Seite kritisiert wird.
Siegmund als unbewusster Erbe Noltes
Konservative Kritiker der Debatte wie der Geschichtsprofessor Thomas Nipperdey argumentierten, dass eine „moralisierende Interpretation von Kontexten“ den wissenschaftlichen Diskussionsprozess sowie die „Pflicht zum permanenten Revisionismus“ aufkündige. Andere, wie der rechte Vordenker Armin Mohler, kritisierten die sogenannte Vergangenheitsbewältigung, da diese die Deutschen ihrer Geschichte beraube. Die deutsche Politik bestehe im Allgemeinen aus der Interpretation der Geschichte, wie der Philosoph Günter Rohrmoser einmal formulierte. Man sieht: Es handelt sich nicht um eine neue Debatte, sondern um die seit Jahrzehnten schwelenden Konflikte darüber, wie wir Deutschen mit der Geschichte umgehen.
Auffällig ist jedoch, dass die Verteidiger der Vergangenheitsbewältigung mittlerweile verkrustet wirken, weil die Form den Inhalt immer stärker überlagert. In diesem Kontext ist die Form, die den Inhalt überlagert, die geschichtspolitische und moralisierende Erwartungshaltung der etablierten politischen und medialen Ordnung in Deutschland. Diese Form bestimmt, wie über die NS-Zeit gesprochen werden muss, damit es als akzeptabel gilt. Sie verlangt eine moralische Interpretation des Holocaust und seine Kategorisierung als absolutes, unvergleichliches Verbrechen (Singularitätsthese). Nur durch diese Feststellung werden die deutsche Schuld-Theologie und das Selbstverständnis der Bundesrepublik, das sich oft „ex negativo“ definiert, bestätigt. Wer sich weigert, diese absolute Singularität zu bestätigen, bricht mit den formalen Spielregeln.
Die Verwechslung von Politik und Moral
Die Form verlangt ein absolutes, emotionalisiertes Bekenntnis zur Singularität der NS-Verbrechen, um die „geistige Beeinflussung der Deutschen“ (Reeducation) und die linksliberale Hegemonie zu sichern. Ihre Einhaltung ist wichtiger als eine differenzierte historische Wahrheit. Siegmund hingegen verlangt intellektuelle Redlichkeit und weigert sich, ein Urteil zu fällen, das eine umfassende empirische Grundlage („gesamte Menschheit“) erfordern würde. Er signalisiert, dass diese Frage nicht durch moralischen Konsens beantwortet werden kann, sondern historisches Wissen über die gesamte Geschichte voraussetzt, welches ihm – nach eigener Aussage – fehlt. Genau hier zeigt sich die Verwechslung von Politik mit Moral, die Fortsetzung der Philosophie in der Politik.
Kurz gesagt: Wer diese Form nicht bedient, gilt nicht als differenziert, sondern als verdächtig. Die Form ersetzt das Denken – und heute noch mehr als früher.
Im Falle der Vergangenheitsbewältigung bedeutet dies, dass die Form – das öffentliche Ritual der Schuldanerkennung – wichtiger wird als die komplexe historische Substanz. Die Formalisierung der Politik ist dabei keine Seltenheit. Wie der Historiker Hans Delbrück erkannte, ist es typisch für absterbende Ideen, dass ihre Träger die Form über den Inhalt stellen und sich an sie klammern, da sie sonst „allen Halt verlieren würden“. Die moralisierende Form dient somit als Ausdruck absterbender Ideen (oder des Mangels an eigenen Inhalten) in der politischen Elite.
Siegmunds Weigerung, ein moralisches Absoluturteil zu fällen, erzwingt die Rückkehr zur Substanz. Diese umfasst erstens die historische Komplexität totalitärer Verbrechen, die sich nicht durch einfache moralische Schemata ersetzen lässt, und zweitens die Wiederbelebung der politischen Auseinandersetzung, indem er die „richtige“ moralische Floskel verweigert. Wirkliche Politik muss sich mit dem Wesen und der Substanz der Handlungsfelder auseinandersetzen.
Ein leiser Sieg Noltes?
Die Substanz der Geschichte zeigt, dass „jedes Stück Geschichte, das aus seinem Boden herausgebrochen und gegenwartsgemäß umgestaltet worden ist, aufhört, etwas Eigenes zu bedeuten“, wie Hans Freyer es formulierte. Es verliert „Inhalt und Würde“ und wird zu einem „Strohmann für gegenwärtige Geschäfte“. Siegmunds Weigerung, die Geschichte zu einem solchen Strohmann der aktuellen Moral zu machen, verteidigt ihren Inhalt.
Historische Wahrheit entsteht nicht aus moralischen Formeln, sondern aus empirischem Wissen. Die Substanz der Geschichte lässt sich nicht durch ein politisches Ritual ersetzen. Davon bleibt die Tatsache, dass der Holocaust zum schrecklichsten Verbrechen der deutschen Geschichte gezählt werden muss, auch weiterhin unberührt.
Die Reaktionen auf den Fall zeigen eine paradoxe Wendung. Der Versuch, Siegmund moralisch zu isolieren, wirkt müde. Die Reaktionen richten sich zunehmend weniger gegen ihn selbst, sondern vielmehr gegen die journalistische Mechanik, die hinter der Skandalisierung steckt. Das ging sogar so weit, dass sich Repinski öffentlich auf der Plattform X erklären musste – oftmals kein gutes Zeichen, wenn man hinterher „Klarheit“ schaffen muss.
Anhand der aktuellen kritischen Reaktionen, die sich zunehmend nicht gegen Siegmund, sondern gegen Repinski richten, lässt sich nun sagen: Vielleicht, so könnte man am Ende leise sagen, hat Ernst Nolte den Historikerstreit doch gewonnen.
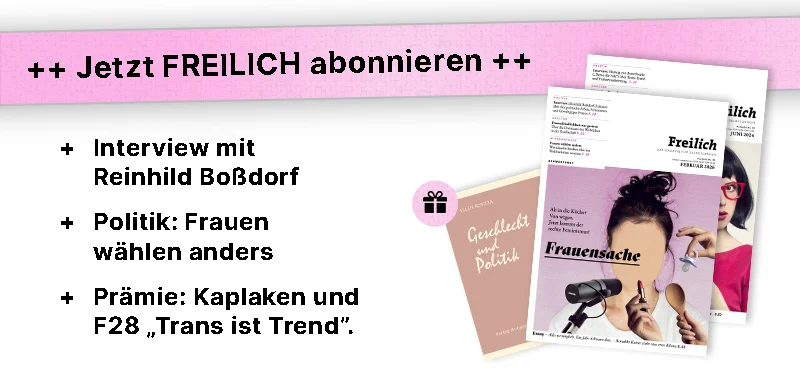

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!