Die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen markiert einen Wendepunkt im Abbau der repräsentativen Institutionen. Der Ausschluss des AfD-Kandidaten Joachim Paul – begründet mit fragwürdigen und schwer greifbaren Vorwürfen der Verfassungsfeindlichkeit – zeigt nicht nur bürokratische Willkür, sondern die innere Logik einer „wehrhaften Demokratie“, die sich in Wahrheit als Rückkehr der Herrschaft Weniger erweist. Gerichte, von der Landeswahlaufsicht bis zum Bundesverfassungsgericht, haben diesen Ausschluss bestätigt, indem sie die abstrakte Norm der „Verfassungstreue“ über den konkreten Volkswillen stellten.
Von der Demokratie zur Herrschaft Weniger
In einer Zeit, in der der Staat („Res publica“) immer mehr zu einer reinen Simulation schrumpft, wo formale Abläufe die echte politische Beteiligung ersetzen, wird Ludwigshafen zum Brennpunkt einer größeren Krise: dem Vertrauensverlust in das bestehende System. Der Fall Paul zeigt die enge Verflechtung von Recht und Macht. Als Vertreter einer Agenda, die Rückführung von Migranten, nationale Eigenständigkeit und die Auflösung linker Deutungen forderte, geriet er in Konflikt mit den dominanten Diskursen des Mainstreams.
Die Entscheidung des Wahlausschusses, gestützt auf Berichte des Verfassungsschutzes, arbeitete mit dem Begriff der „nachgewiesenen Verfassungsfeindlichkeit“ – ein schöner Ausdruck für ideologische Unverträglichkeit. Mehrere Instanzen, darunter das Oberverwaltungsgericht Koblenz und das Verfassungsgericht Rheinland-Pfalz, bestätigten diese Praxis, am Ende auch das Bundesverfassungsgericht. Das Recht wird damit zum Werkzeug der Ausgrenzung, das eine politische Entscheidung verdeckt und die Einheit des Systems schützt.
Recht als Werkzeug der Ausgrenzung
Indem Paul von der Wahlliste gestrichen wurde, wurde nicht nur ein Kandidat ausgeschlossen, sondern auch die Illusion echter Konkurrenz zerstört. Die übrigen Kandidaten – Klaus Blettner (CDU/FWG) mit 41,2 Prozent, Jens Peter Gotter (SPD) mit 35,5 Prozent, Martin Wegner (Einzelbewerber) mit 15,7 Prozent und Michaela Schneider-Wettstein (Volt) mit 7,6 Prozent – stehen für eine geschlossene Gruppe etablierter Kräfte, deren Unterschiede nur äußerlich sind.
Die Zahlen belegen das Ausmaß dieser Entwicklung. Die Wahlbeteiligung fiel auf ein Rekordtief von 29,3 Prozent – ein Absturz von über 30 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl 2017. Diese Passivität ist kein Naturgesetz, sondern eine bewusste Entscheidung: ein Akt des zivilen Ungehorsams gegen eine entmachtete Bürgerschaft. Dazu kommt eine Besonderheit: 9,2 Prozent ungültige Stimmen, darunter hunderte Zettel mit handschriftlichen Hinweisen wie „Paul für OB!“ oder bloßen Strichen des Widerstands.
Solche Botschaften aus der Wahlurne – nicht als Fehler, sondern als Zeichen – durchbrechen die offizielle Deutung des Systems. Sie zeigen eine Protestlogik, die den Bürgern ihre Rolle als handelnde Subjekte zurückgibt: In einer Situation, wo die Wahl nur noch Zustimmung zum Status quo bedeutet, wird die ungültige Stimme zum Mittel des Widerstands.
Simulation statt Demokratie – die Folgen für Deutschland
Die Herrschenden – eine Allianz aus Berliner Zentralregierung, politisierter Verwaltung und etablierten Medien – spielen diese Phänomene herunter als „Entpolitisierung“. Tatsächlich handelt es sich um eine deutliche Ironie: Eine Beteiligung von unter 30 Prozent schwächt jede demokratische Grundlage. Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes sagt klar, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht; eine solche Quasi-Demokratie täuscht nur Zustimmung vor, wo in Wahrheit Ablehnung herrscht. In anderen Bundesländern zeigt sich künftig gewiss dasselbe Muster: AfD-Kandidaten werden mit Hilfe von Verfassungsschutzakten ausgeschlossen, was wiederum zu Wahlverweigerung führen wird.
Die Stichwahl am 12. Oktober zwischen Blettner und Gotter ist daher als Fortsetzung der Simulation zu sehen. Pauls Ankündigung einer Klage, mit Verweis auf die fehlende Repräsentativität, kann und wird hier – hoffentlich – einen Präzedenzfall schaffen.
Aufbruch gegen den Stillstand
Die „wehrhafte Demokratie“ bleibt damit ein verkleideter Totalstaat, in dem die Theorie vom Feind nicht den Extremismus bekämpft, sondern das Volk beruhigen soll. Die Stadt, belastet durch Schulden und Sozialkosten, wird zum Experimentierfeld der Entmachtung; der Oberbürgermeister, ob Blettner oder Gotter, bleibt nur Ausführer zentraler Vorgaben.
Die Rechte – als Trägerin der Rationalität – muss die Deutungshoheit durchbrechen, indem sie Widerstand als Ausdruck der Eigenständigkeit, Eigenständigkeit als Gegenmittel zum Globalismus und Zentralismus und die Abschaffung linker Ideologien als Befreiung von kulturellem Stillstand formuliert. Netzwerke jenseits staatlicher Kontrolle – von Gemeinderäten bis zu oppositionellen Publikationen – bilden die Vorhut dieses Kampfes. Die CDU, Mitakteurin beim Ausschluss, verliert noch mehr als ohnehin schon weiter ihr Bild als Bollwerk gegen Links; SPD und Grüne treiben ihren rückwärtsgewandten Fortschritt voran. Die ungültigen Stimmen als Zeichen des Übergangs deuten den Wechsel an: von der Resignation zum Aufbruch. Ludwigshafen zeigt die Fiktion der BRD-Demokratie als Ganzes. Der Kampf um ihre Wiederherstellung – durch Wiederholung von Wahlen mit zu geringer Beteiligung, durch politische Mobilisierung außerhalb des Systems – ist unausweichlich. Die Wahrheit wird siegen, weil sie notwendig ist.
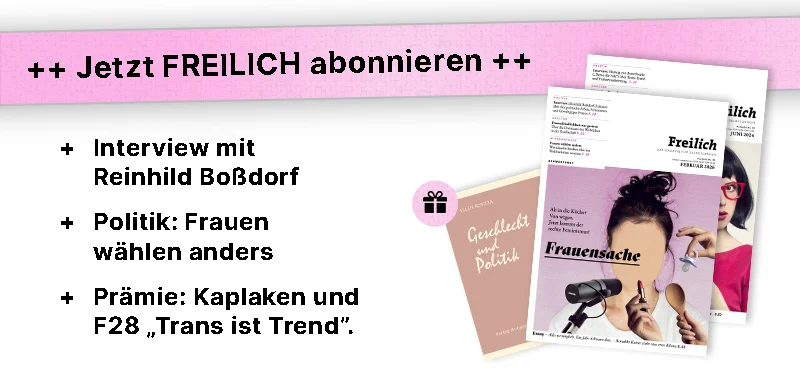

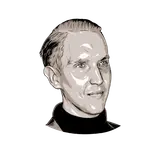

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!