München. – Die großen Namen der deutschen Autoindustrie stehen unter Druck. Die Absatzmärkte stagnieren, die Lieferketten sind fragil und die Transformation hin zur Elektromobilität kostet Milliarden. In dieser Situation richten viele Unternehmen ihren Blick auf eine Branche, die seit dem Beginn neuer geopolitischer Spannungen boomt: die Rüstungsindustrie.
Doch wer in diesem Bereich mitmischen will, steht vor einem hochregulierten Umfeld. „Wer in die Rüstungsindustrie einsteigen will, findet ein ganz anderes rechtliches Umfeld vor als in der klassischen Industrie“, erklärt Dr. Nicolas Kredel gegenüber der Frankfurter Rundschau. Er ist Partner der internationalen Kanzlei Baker McKenzie und Leiter der globalen Industriegruppe „Industrials, Manufacturing and Transportation“. Er betont die besondere Rolle des Staates auf diesem Markt: „Besonders wichtig sind das deutsche und das europäische Vergaberecht, da der Staat meist einziger Kunde ist.“
Strenge Auflagen und sensible Daten
Neben juristischen Aspekten müssen Unternehmen auch technische und sicherheitsrelevante Hürden meistern. „Hinzu kommen Vorgaben zur Produktion, etwa dass ein bestimmter Anteil innerhalb der EU gefertigt sein muss.“ Bei der Planung von Kooperationen ist zudem das Kartellrecht zu berücksichtigen. „Wer mit anderen Unternehmen kooperiert oder Joint Ventures gründet, muss zudem fusions- und investitionsrechtliche Vorschriften beachten. Nicht zuletzt gelten strenge Regeln zum Schutz vertraulicher Daten“, so der Experte.
Kooperationen als Schlüssel zum Erfolg
Ob Partnerschaften oder Eigenentwicklung – laut Kredel hängt die richtige Strategie von den bestehenden Kompetenzen ab. Einige Zulieferer könnten demnach direkt in den Markt eintreten: „Wer zum Beispiel ein bestimmtes Bauteil – beispielsweise für einen Panzer – liefern kann, braucht oft keine neue Struktur, sondern kann vielleicht als Zulieferer auftreten.“
In anderen Fällen kann die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens sinnvoll sein, etwa wenn Know-how von mehreren Partnern nötig ist oder regulatorische Vorgaben wie Lokalisierungsvorschriften bestehen. Ein Beispiel hierfür ist die Kooperation zwischen Rheinmetall und Leonardo, die Panzerfahrzeuge fertigen, die vom italienischen Staat in Auftrag gegeben wurden.
Autohersteller als neue Rüstungsplayer
Viele der derzeitigen Initiativen bleiben vertraulich. „Wir sind in diesem Hinblick zur Vertraulichkeit verpflichtet“, betont Kredel. Öffentlich bekannt sei jedoch die Kooperation von Daimler Truck mit Arquus. Auch andere Akteure würden Interesse zeigen: „Die Porsche-Familienholding verlautbarte, dass sie in den Verteidigungsbereich investieren will“, so Kredel.
Dabei geht es nicht nur um große Konzerne. „Teilweise sind es einfach auch wirklich kleine Komponentenhersteller, also Anbieter von elektronischen Bauteilen oder ähnlichem, die sich überlegen, mit den großen Systemhäusern Kooperationen einzugehen“, erklärt Kredel.
Ein zentrales Thema beim Einstieg in die Verteidigungsproduktion ist die Frage nach sogenannten Dual-Use-Gütern. „Dual Use bedeutet, ich kann ein bestimmtes Produkt für zivilen Nutzen, aber auch für militärischen Nutzen hernehmen.“ Ein anschauliches Beispiel sind Software oder Elektronik, die sowohl in die Zielsteuerung für ein Geschütz als auch für ein Auto oder einen Zug eingebaut werden können.
Imagewandel: Rüstung ist kein Tabu mehr
Noch vor wenigen Jahren galt die Waffenproduktion als heikles Terrain für Unternehmen, die ein ziviles Markenimage pflegen. Doch Kredel sieht einen gesellschaftlichen Wandel. „Vor fünf bis zehn Jahren war die Verteidigungsindustrie ein bisschen in der Schmuddelecke“, sagt er. Heute wird Verteidigung anders bewertet: „Das ist nach meiner Wahrnehmung nicht mehr der Fall, weil man mittlerweile an einer recht breiten Front der Gesellschaft verstanden hat, dass es hier um die Sicherung und Verteidigung der Demokratie und des Rechtsstaats geht.“ Er beobachtet eine wachsende Akzeptanz: „Und insofern sehen die Leute, dass die Verteidigungsbereitschaft durchaus was Positives hat, um die Art, wie wir leben, zu sichern. Das ist, glaube ich, in der Gesellschaft angekommen.“
Langfristige Perspektiven statt Schnellschüsse
Unternehmen, die den Schritt wagen wollen, sollten sich laut Kredel vorab sehr gut überlegen, ob sie eine langfristige Investition tätigen möchten, „denn nur vorübergehend geht es nicht“. Er mahnt zur sorgfältigen Vorbereitung: „Man muss die entsprechenden Strukturen, Kenntnisse und Fähigkeiten aufbauen, um mit speziellen Kunden, den speziellen regulatorischen Vorgaben und den Gesetzen dieses Marktes umzugehen.“
Trotz der Herausforderungen sieht der Jurist enormes Potenzial: „Ich erwarte, dass sich der Bereich stark weiterentwickelt. Der Bedarf ist hoch und es ist auch nicht abzusehen, dass die Notwendigkeit von Verteidigung irgendwann nachlassen würde in der allernächsten Zeit.“
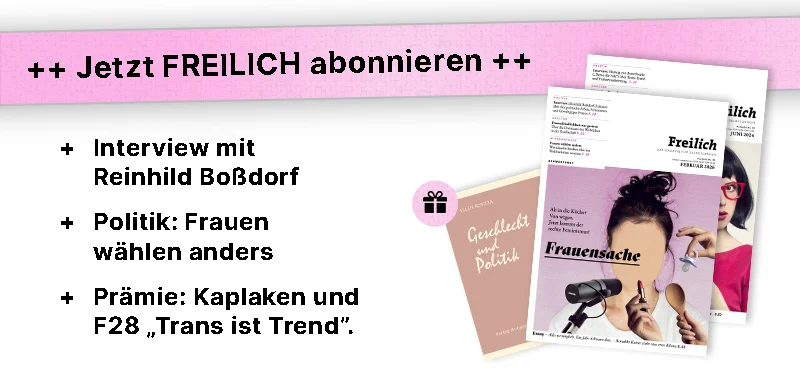


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!