Die Banknote: vorne Peter der Große auf seinem Podest im grauen Archangelsk, die Hafenstadt – Schiffe, Kräne, dahinter das Meer, das in dieser Farbe nie wirklich blau war. Dreht man den Schein, sieht man das Solowezki-Kloster, Insel der Heiligen und der Gefangenen, steinernes Herz des Nordens. Ich erinnere mich, was man dafür alles bekam – ein ganzes Wochenende Jugend. Ein Päckchen Prima-Zigaretten, ein billiges Bier im Kiosk, vielleicht sogar zwei, oder eine Zugfahrt irgendwohin, wo man noch nichts verloren hatte. Ein Stück melancholischer Währungsromantik – der 500-Rubel-Schein.
Die anonyme Regie der Macht
Doch die Zeiten ändern sich. Niemand weiß, wer sie ändert. Vielleicht Leute in grauen Anzügen, die die Welt schieben wie Bretter auf einer Bühne, diejenigen Requisiteure der Geschichte. Es ist ihr Job, Fortschritt zu erzeugen, damit der Mensch glauben kann, er sei etwas anderes als ein Insekt oder ein leuchtender Punkt im All. So steht es wohl irgendwo in den Richtlinien des Zeitenwendeamtes.
Daher also die Modernisierungsroutine: und am besten modernisiert man das, woran der Mensch sich noch festhält – das Geld. Nicht etwa das Fiat-Geldsystem selbst – um Himmels willen, nein. Nur das Papier, das Bild. Auch der 500-Rubel-Schein blieb davon nicht verschont.
Zuerst also das Layout, die Typografie, das Farbklima – alles erinnert verdächtig an eine ironische Kopie des 500-Euro-Scheins. Nur dass der Rubel, mehrfach entwertet, dieselbe Ziffer trägt. Und was das Bild darauf betrifft, so verhält sich die russische Zentralbank wie ein zeitgenössischer Regisseur, dem nichts mehr einfällt – sie setzt auf Mitmachtheater. Wenn der Bürger sonst kaum mehr gefragt wird, warum ihm nicht ein sicheres Spielzeug geben – ein Sandkasten, in dem man Demokratie üben darf, ohne dass etwas zerbricht.
Modernisierung als Ersatzhandlung
Am 1. Oktober 2025 startete die russische Zentralbank ein ungewöhnliches Experiment: In einer Online-Abstimmung durften die Bürger entscheiden, welches symbolische Motiv die neue 500-Rubel-Banknote der Russischen Föderation zieren sollte: der Elbrus, höchster Berg Russlands, oder der Wolkenkratzerkomplex Grosny-City in Tschetschenien.
Die Geschichte des Landes ist reich an Bildern, die sich wie eine ornamentale Haut auf das Papier des Rubels legen könnten: Kurtschatow, Tolstoi, Mendelejew, Tschaikowski, Gagarin. Namen, die nach Größe klingen, nach Zuversicht.
Aber Grosny-City: ein Cluster gläserner Türme – Businessviertel, Hotel und Wohnanlage zugleich. In der Nähe steht die neu errichtete, größte Moschee Europas. Abgesehen von der ganzen Kadyrow-Thematik, die wir später besprechen werden, bleibt die Frage: Wem fällt eigentlich ein, Hochhäuser auf eine Banknote zu drucken? Es sind keine Weltwunder, keine Träger von Geschichte. Man hätte dieselben Glastürme in jeder beliebigen Stadt abbilden können – austauschbar, anonym, leer. Nur in Tschetschenien hat man beschlossen, auf solche Neubauten stolz zu sein.
Glasfassaden oder Gipfel: Zwei Symbole, zwei Welten
Grosny-City, gedacht als Symbol des Wiederaufbaus, ist heute ein stiller Ort. Von echter wirtschaftlicher Dynamik kann man kaum sprechen – Tschetschenien ist ein subventioniertes Land mit geringer Marktbewegung, für ein Businesszentrum solchen Ausmaßes gibt es schlicht keinen Bedarf. Kaum Menschen, leere Büros, Fassade statt Funktion. Ein Businesszentrum, das nichts produziert außer den Eindruck, eines zu sein.
Die vorgeschlagene Alternative: der schneebedeckte Elbrus. Der Berg erhebt sich mit zwei Kegeln aus dem Hauptkamm des Kaukasus – ein massiver, oft wolkenverhangener Vulkan von beeindruckender Symmetrie. Mit seinen sanft ansteigenden Hängen und breiten Firnfeldern wirkt er weniger schroff als andere Kaukasusberge, doch seine Größe und Einsamkeit machen ihn einzigartig. Ich sage es so, wie es ist: Man kennt sie, diese Währungen mit Bergen und Tieren – exotische Papierträume von Staaten, die weder Kathedralen errichtet noch große Gelehrte hervorgebracht haben. Russland hingegen spielte stets in einer anderen Sphäre – so nüchtern wie überlebensgroß.
Die Mobilisierung der Massen – um jeden Preis
Entscheidend ist heute nicht mehr, was Russland einst war, sondern was dort gerade geschieht. Schon kurz nach Beginn des Votings lag der Elbrus deutlich vorn – laut einigen Quellen mit einem Vorsprung von zwei- bis dreimal so vielen Stimmen. Daraufhin griff die tschetschenische Führung ein, und Ramsan Kadyrow persönlich beschloss, seine Landsleute zu mobilisieren – mit einer Lotterie.
Am 10. Oktober schrieb er in seinem Telegram-Kanal: „Je näher das Ende der Abstimmung rückt, desto heißer wird der Kampf! Ich starte einen Wettbewerb: Wir verlosen zehn iPhone 17 unter allen, die für Grosny-City stimmen!“ Eine heikle Nuance: Man konnte insgesamt viermal abstimmen – über die Website der Zentralbank, das Portal „Gosuslugi“ sowie über VKontakte und Odnoklassniki –, anschließend Screenshots machen und sie mit dem Hashtag #ГолосуюЗаЧечню („Ich stimme für Tschetschenien“) posten.
Von Jubel bis Zwang: Die digitale Schlacht
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: In den Sozialen Netzwerken brach eine Welle aus Jubel und Memes los. „Unser Ramsan – der König! Ein iPhone fürs Vaterland, das ist unser Stil!“, schrieben Nutzer begeistert. Selfies mit Beweisfotos fluteten das Netz, die Kampagne erreichte Millionen Aufrufe. Tschetschenische Blogs, Telegram-Kanäle und Influencer wurden gezielt aktiviert, um das Ergebnis zu beeinflussen. Einige berichteten, dass Beamte und Studenten unter Druck gesetzt worden seien, mehrfach abzustimmen.
Die Gesellschaft reagierte mit Spott und Humor: Auf TikTok und VK kursierten Memes wie „Kadyrow bringt der Zentralbank Marketing bei“ oder „Ein iPhone 17 für 500 Rubel? Klingt nach dem Deal des Jahrhunderts“. Laut offiziellen Angaben gingen rund 100.000 Stimmen für Tschetschenien ein.
Wenn der Wettbewerb kippt
Die Medien griffen das Thema auf: Lenta.ru und RIA Nowosti berichteten über den „umfangreichen Wettbewerb“, allerdings mit ironischem Unterton über den „Krieg um die Banknote“. Militärkorrespondenten witzelten: „Bald werden sie für Stimmen Panzer verlosen.“ Je länger die Abstimmung dauerte, desto sichtbarer wurden die Verschiebungen – plötzlich gewann Grosny-City an Gewicht, als hätte jemand am Algorithmus gedreht. Misstrauen machte sich breit.
Im russischen Internet begann eine riesige Welle der Zustimmung für den Elbrus – nicht aus Liebe zum Berg, sondern als instinktiver Reflex. Die tschetschenischen Behörden warfen daraufhin vor, die Spielregeln seien geändert worden, sobald Grosny-City zu gewinnen begann: „Keiner unserer Aufrufe zur Stimmabgabe enthielt auch nur den leisesten Hinweis auf die Anstachelung ethnischer Feindseligkeit – im Gegensatz zu unseren Gegnern“, erklärte der tschetschenische Minister für Presse und Information, Achmed Dudajew. „Wir hoffen, dass in dieser Abstimmung gerade die Nazis eine Niederlage erleiden werden.“ Fast klang es, als wäre es wieder August 1942 – als die Gebirgstruppen der Wehrmacht den Elbrus, die verschneite „Achse der Welt“, erstürmten.
Die Rückkehr des Alten
Zwei Wochen später zog die Zentralbank den Stecker – offiziell wegen „technischer Manipulationsversuche“ – und erklärte alle Ergebnisse für ungültig. Die Server schwiegen, doch die Fragen blieben. Viele fragten sich, warum man überhaupt das Bild auf dem 500-Rubel-Schein ändern sollte. Was wäre wohl herausgekommen, hätte man die Möglichkeit gelassen, für das Alte zu stimmen – für Peter den Großen und das Solowezki-Kloster? Hätte man die Wahl gelassen, Russland hätte wohl für sich selbst gestimmt – für das, was bleibt.
Wie sich zeigte, hatte die Zentralbank längst neue Scheine mit den alten Symbolen entworfen. Sie sahen gut aus, ruhig, vertraut. Offenbar war genau das das Problem. Schon im vergangenen Jahr erklärte Sergei Below, stellvertretender Vorsitzender der Zentralbank, man wolle religiöse Motive künftig vermeiden: „Auf den Banknoten der Serie von 1997 waren noch ikonische Bauwerke abgebildet. Doch mit der Neugestaltung und dem Übergang von einer städtischen zu einer regionalen Serie – bei der jede Banknote nun einem der föderalen Bezirke gewidmet ist – beschlossen wir zugleich, auf Darstellungen religiöser Objekte zu verzichten. Dieses Prinzip werden wir auch bei den künftig zu modernisierenden Banknoten beibehalten. Russland ist schließlich ein multinationales und multikonfessionelles Land.“
Tilgung der Symbole: Die stille Kulturrevolution
Die eigentliche Absicht dieser Neugestaltung ist klar: Man will die Kreuze tilgen, das Solowezki-Kloster ausradieren – angeblich im Namen des konfessionellen Friedens. Vielleicht ist es kein Zufall: Elvira Nabiullina, einst Young Global Leaderin des Weltwirtschaftsforums, erscheint wie die russische Version von Christine Lagarde – derselbe rätselhafte Geschmack für auffälligen Schmuck, voller Anspielungen, deren Bedeutung man lieber nicht kennt. Unter ihrer Aufsicht verschwanden 300 Milliarden Dollar in westlichen Tresoren. Man könnte glauben, sie diene nicht Moskau, sondern der Fed. Es bringt keinen Frieden, wenn man die gewachsene Identität eines Landes auslöscht. Nur Streit. Man sieht schon, wie er anfängt. In kleinen Dingen zuerst. Dann überall.
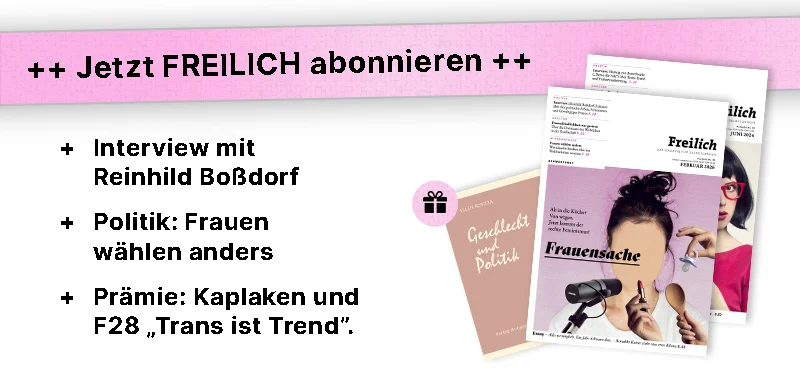


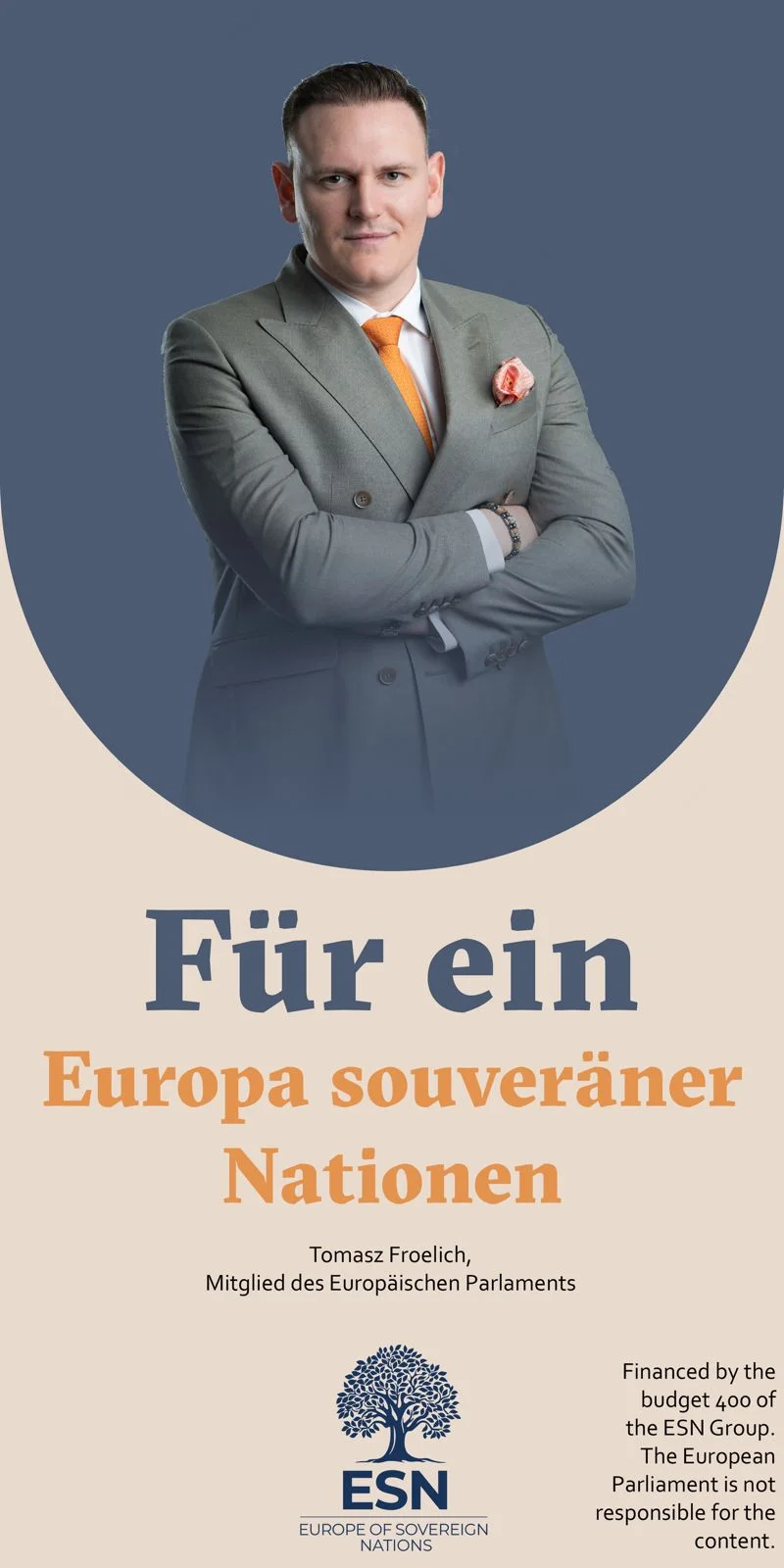

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!