Frankreich bereitet seine Krankenhäuser auf den Ernstfall vor. Zehntausende Verwundete binnen weniger Monate, mobile Behandlungszentren an Häfen und Flughäfen, eine nationale medizinische Reserve im Schatten eines möglichen Krieges. Offiziell ist von einem „major military engagement“ die Rede – von Verwundetentransporten, die aus den Frontlinien Osteuropas nach Westen verlegt werden müssten. So lautet die Sprache der Regierung, nüchtern, strategisch, scheinbar folgerichtig.
Die Logistik eines kommenden Ernstfalls
Eine zentrale Quelle dafür ist ein Schreiben des französischen Gesundheitsministeriums vom 18. Juli 2025, das laut Le Canard enchaîné an die regionalen Gesundheitsbehörden verschickt wurde. Demnach sollen die Krankenhäuser bis März 2026 bereit sein, 10.000 bis 50.000 Verwundete innerhalb von 10 bis 180 Tagen aufzunehmen. Der englische Independent berichtet ausführlich darüber und verweist auf die Möglichkeit, dass Frankreich als „rear base“ für alliierte Truppen dienen soll.
Doch hinter dieser Rhetorik verbirgt sich eine tiefere Ambivalenz. Während die Begriffe „Krieg“ und „Front“ unweigerlich nach Russland und NATO klingen, deuten die genannten Zahlen – Verwundetenzahlen im fünfstelligen Bereich – auf ein anderes Szenario: jenes der inneren Erosion. Frankreich kennt diese Zonen der Instabilität seit langem: die flammenden Banlieues, die Protestwellen der Gelbwesten, die eruptiven Straßenschlachten, die sich binnen Stunden in bürgerkriegsähnliche Zustände verwandeln können. Auch England liefert mit den jüngsten Ausschreitungen in London ein Menetekel, wie rasch sich urbane Zentren in Zonen massenhafter Gewalt verwandeln können.
Die doppelte Sprache der Macht
Die Kriegssemantik ist dabei nicht zufällig gewählt. Sie erfüllt eine doppelte Funktion. Einerseits verschleiert sie, dass Regierungen längst die eigene gespaltene Gesellschaft beziehungsweise Oppositionskräfte als potenzielles Sicherheitsrisiko betrachten. Wer von Moskau spricht, muss nicht von Marseille reden. Wer den „Feind“ im Osten beschwört, muss nicht von den zerbrochenen Loyalitäten im Inneren sprechen. Andererseits schafft die Kriegsrhetorik Legitimität, um Ressourcen zu mobilisieren – Milliarden für Notfallkapazitäten, Reserven und Infrastruktur, die offiziell der äußeren Abschreckung dienen, in Wahrheit aber auch für die innere Kontrolle nutzbar sind.
Deutschlands nüchterner Weg
Deutschland liefert hierzu eher noch ein Gegenbild. Hier bleibt der Diskurs nüchtern, fast entpolitisiert. Man spricht von „kritischen Infrastrukturen“, „Resilienz“ oder testet beim Warntag das „Warnmix-System“. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK arbeitet an Schutzraumkonzepten, die Länder entwerfen Rahmenpläne für Krankenhäuser, Berlin hat jüngst seinen „Rahmenplan Zivile Verteidigung“ vorgestellt. Alles wirkt technokratisch, administrativ, in die Sprache der Verwaltung gegossen. Doch auch hier gilt: Der Ernstfall, auf den man sich vorbereitet, hat keinen Namen: Pandemie, Blackout, Krieg, Aufstand – alles wird in der neutralen Vokabel des Katastrophenschutzes zusammengeführt.
So entsteht ein paradoxes Bild. Frankreich signalisiert mit militärischer Direktheit Handlungszwang, Deutschland verhüllt die gleiche Sorge in technokratischen Formeln. Doch die Gemeinsamkeit bleibt: Beide Systeme ringen mit derselben Angst. Denn die eigentliche Totalität der Bedrohung liegt darin, dass Krieg und Aufstand keine Gegensätze mehr sind. Die Verwundeten, für die Frankreich Betten zählt, könnten ebenso Opfer von Gefechten an der Ostfront wie von Straßenschlachten in den Vorstädten sein.
Ein Dokument der Zerrissenheit
Frankreichs Schreiben vom 18. Juli ist damit mehr als ein geopolitisches Signal. Es ist ein Dokument der Unsicherheit Europas über sich selbst – über seine innere Integrität, seine zerreißenden Gesellschaften, seine brüchige Souveränität. Der Feind steht nicht nur draußen; er wohnt längst im eigenen Haus. Und die größte Schlacht der kommenden Jahre wird nicht an den Grenzen geführt, sondern im Herzen der Metropolen – in Krankenhäusern, die zugleich Lazarett der Front und Spiegel innerer Zerrissenheit sind.
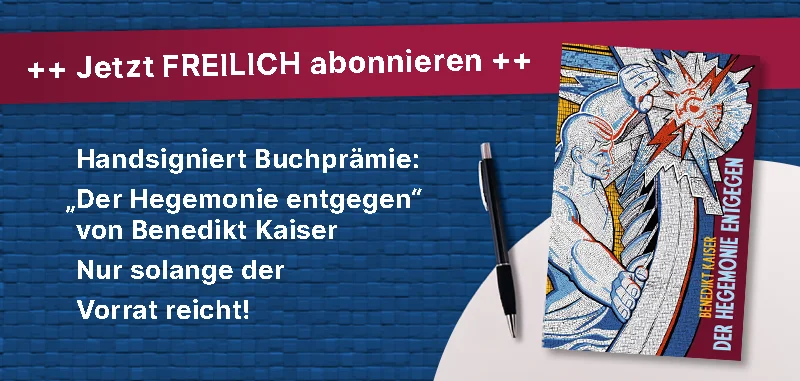
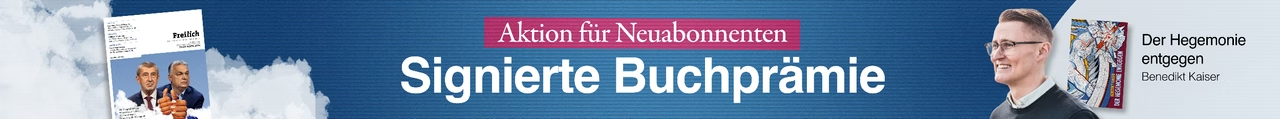

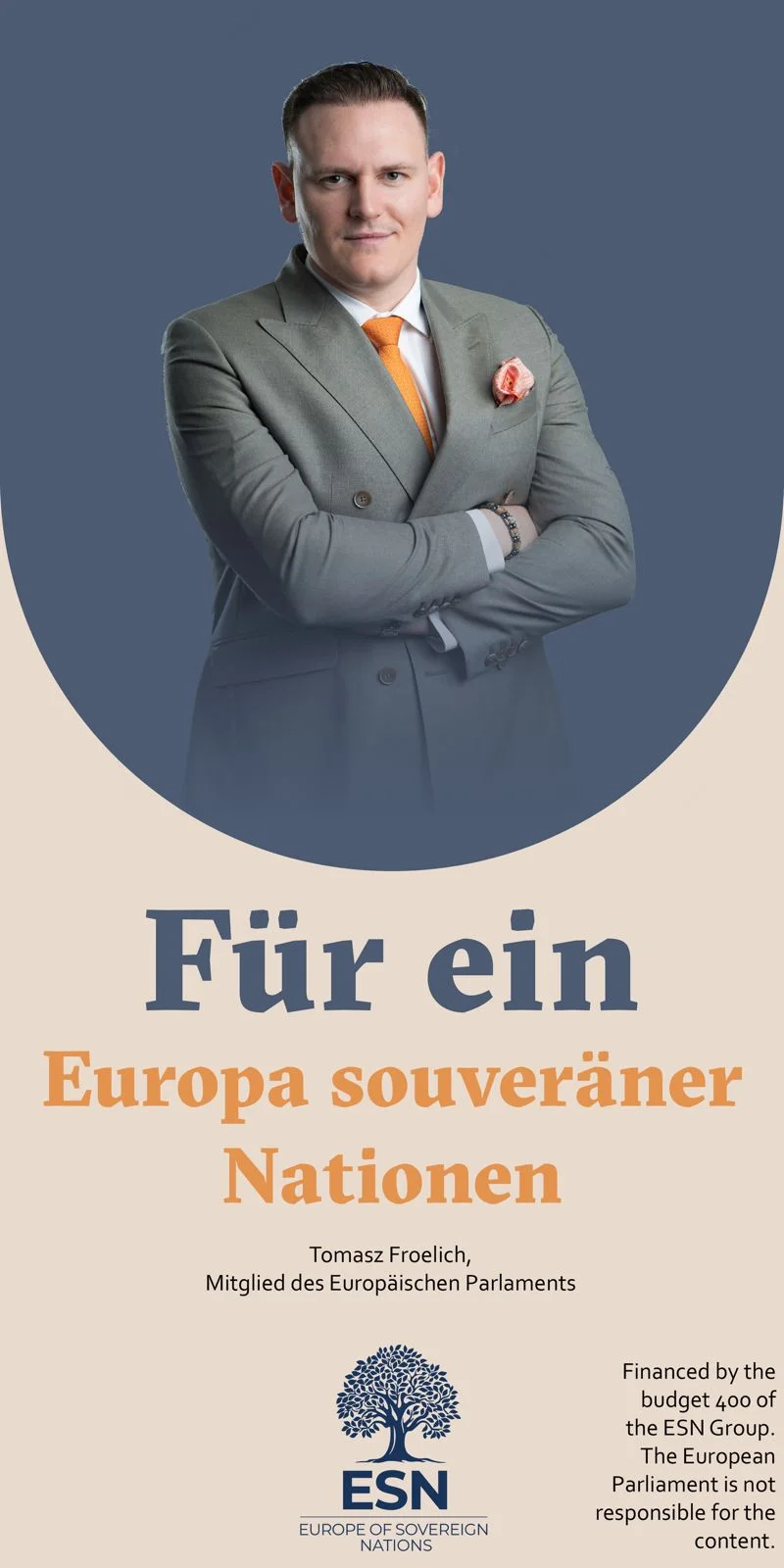

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!