Berlin. – Kultur soll Brücken schlagen, doch in der aktuellen Bundesregierung wird sie zunehmend zur geopolitischen Pflichtübung. Staatsminister Wolfram Weimer betonte in Bezug auf die Studie „Resonanzen. Die deutsch-israelischen Kulturbeziehungen” kürzlich in einer Pressemitteilung: „Kultureller Dialog schafft Räume für Empathie und Reflexion. Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie wichtig Kultur als Brücke zwischen unseren Gesellschaften ist – sie verbindet, wo Politik trennen kann.“ Er fordert, die „Freundschaft unserer Länder gegen ideologische Verzerrungen und antiisraelische Ressentiments“ zu verteidigen und rückt damit die Kulturförderung in den Rang einer außenpolitischen Mission.
Die neue Studie liefert die argumentative Grundlage für diese Linie. Die vom Institut für Neue Soziale Plastik herausgegebene und von der Landecker Foundation finanzierte sowie vom Deutschen Kulturrat ideell unterstützte Untersuchung empfiehlt eine intensivere staatliche Förderung der deutsch-israelischen Kulturarbeit.
Studie ruft nach „mehr Resonanz“ – und Geld
Die Autorinnen Hannah Dannel und Gila Baumöhl beschreiben das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel als „schwingungsfähiges System“, das empfindlich auf politische Erschütterungen reagiert. In seiner Bestandsaufnahme fordert das Institut ausdrücklich neue finanzielle und strukturelle Förderungen für bilaterale Projekte, besonders in Kunst und Kultur. Es brauche „dringend kulturpolitische Anreize, die den Austausch fördern“.
Die Studie konstatiert eine „Resonanzkatastrophe“: Obwohl die Bundesregierung jährlich Millionen in Wissenschaftsprogramme investiert, fehle es den Künsten an vergleichbarer Unterstützung. Im Vergleich zu anderen Ländern würden israelische Künstler seltener eingeladen, was teilweise auf die Angst vor „Shitstorms“ oder Boykottaufrufen zurückzuführen sei.
Auch Weimer bedient sich dieser Erzählung: „Kultur darf niemals zum Werkzeug der Ausgrenzung werden. Sie ist das Fenster in die Welt des Anderen.“ Der Staatsminister zeigte sich besorgt über die zunehmende Ausgrenzung jüdischer Kulturschaffender und verwies dabei auf den israelischen Dirigenten Lahav Shani oder jüdische Künstler beim Eurovision Song Contest.
Mehr Kooperationen gefordert
Im Vorwort der Studie berichtet die Leiterin des Instituts, Stella Leder, von einem „stillen Boykott“ israelischer Künstler: So sei eine Bewerberin abgelehnt worden, da eine israelische Besetzung „in diesen Zeiten“ nicht opportun sei. Gleichzeitig konstatiert die Studie, dass „wesentlich weniger finanzielle Mittel für Kultur und den Kulturaustausch zur Verfügung“ stünden und das Ausland weniger israelische Künstler einlade. Daraus folgert sie, die Kooperationen mit israelischen Künstlern und Kultureinrichtungen ausbauen zu müssen.
Die Autorinnen fordern, die Unsicherheiten der deutschen Kulturinstitutionen anzusprechen und „Dialogräume“ offenzuhalten. Zu diesem Zweck sollen gezielte Förderstrukturen entstehen, die von Stipendien über Residenzprogramme bis zu neuen Preisvergaben reichen.
Vom Austausch zur Staatsräson
Das Schlusskapitel der Studie deutet an, wohin die kulturpolitische Reise führen soll. Demnach müsse Deutschland seine „besondere Verantwortung“ für Israel in konkrete Politik übersetzen. Angela Merkel hatte bereits 2008 in der Knesset erklärt, die „Sicherheit Israels“ sei „niemals verhandelbar“ und „Teil der Staatsräson“. Die Autorinnen greifen diese Formel auf, um eine kulturpolitische Pflicht zur Stärkung der israelischen Zivilgesellschaft zu begründen.
Weimer knüpft nahtlos an diese Argumentation an. Seine Behörde unterstützt bereits Projekte zur Förderung jüdischen Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus, darunter die Berliner Ausstellung zum Nova-Music-Festival und den „Aktionstag Halle“.
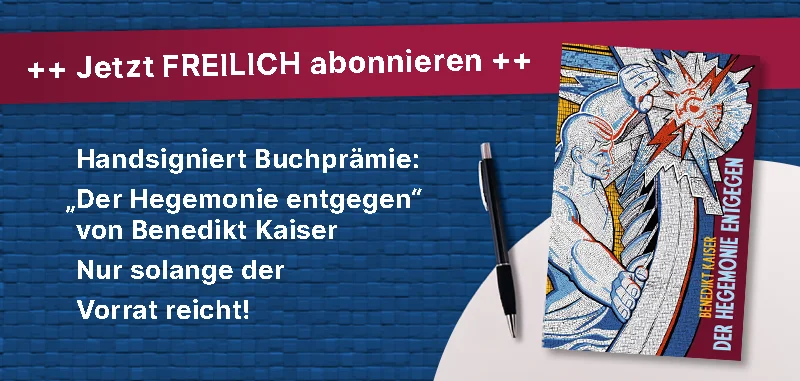
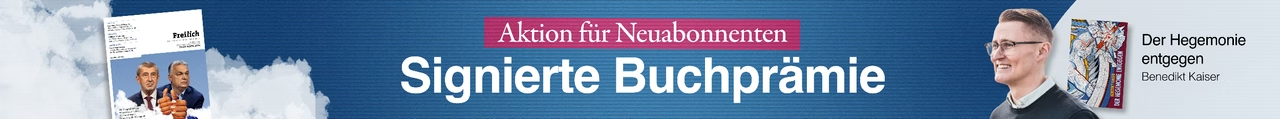

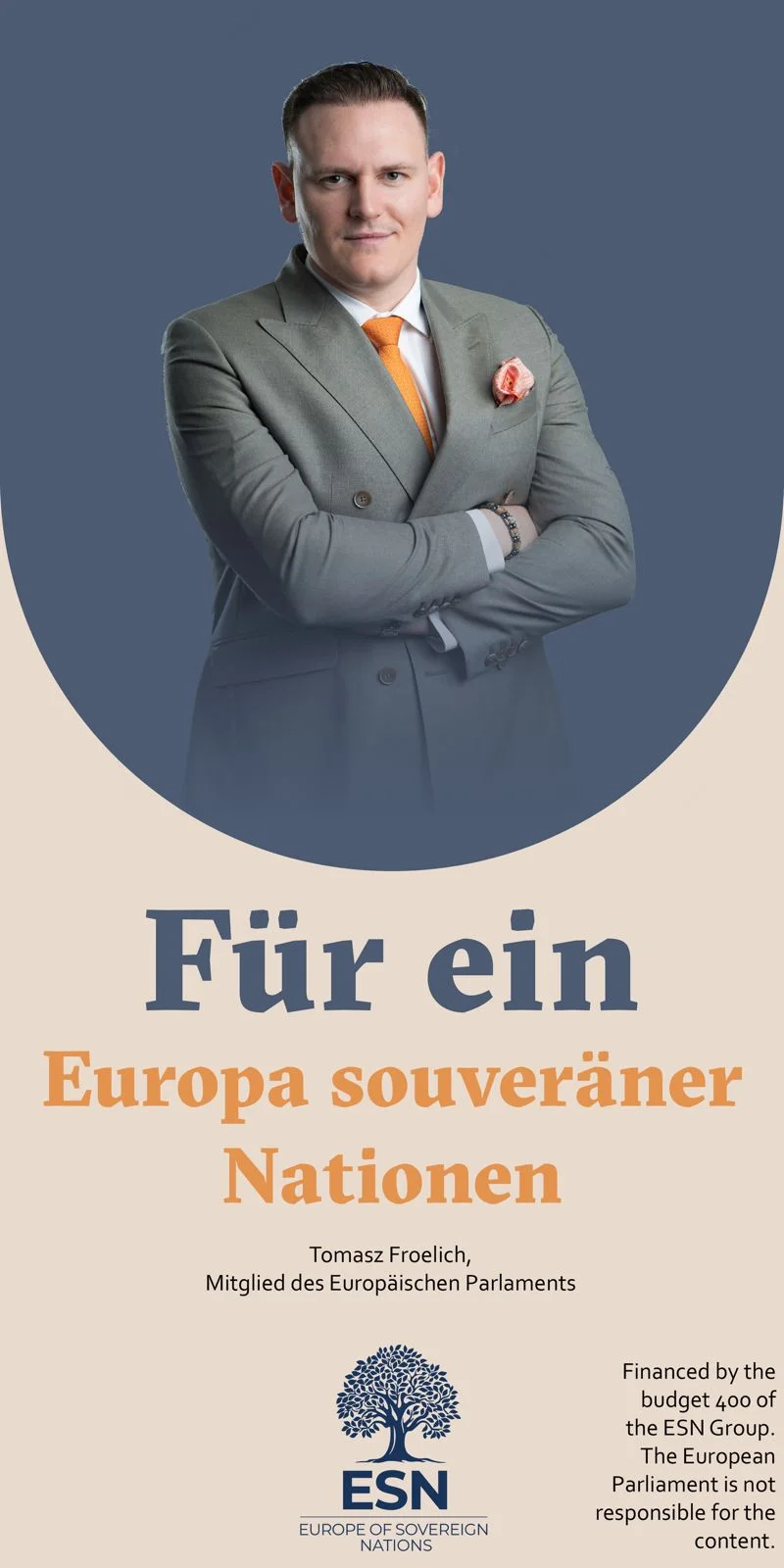

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!