Alexander Gauland ist der Grandseigneur des deutschen Konservatismus. Viele Jahrzehnte wirkte der 1941 in Chemnitz geborene Wahlhesse, dann Wahlbrandenburger auf verschiedenen Posten: Er war für einen CDU-Ministerpräsidenten der Leiter der Hessischen Staatskanzlei, später viele Jahre lang Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Brandenburg, hernach Landesvorsitzender der AfD ebendort, dann sogar AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzender. Gauland war aber nicht nur das Aufgeführte: Er war vieles weitere mehr.
Zu dem „vielen weiteren“ ist vor allem seine Rolle als Autor und Denker anzuführen. Seine Helmut-Kohl-Biografie, zuletzt 2020 aufgelegt, ist ein Standardwerk, Gemeine und Lords, seine 1989 publizierte klassenanalytische Liebeserklärung an die britische Politik und Gesellschaft, ohnehin. Daneben schrieb er auch für die Leitmedien der bundesdeutschen konservativen Intelligenz: In Criticón, dem Vorläufer der Sezession, schrieb er beispielsweise über viele Jahre hinweg luzide Aufsätze und Porträts, bevorzugt zu politisch-historischen Protagonisten der angelsächsischen Sphäre.
➡️ Jetzt bestellen: Alexander Gauland – DDR. CDU. AFD. Ein wider Willen politisch bewegtes Leben
Dieses reichhaltigen schöpferischen Tuns, das hiermit nur in groben Rissen gezeichnet wird, muss man sich wieder bewusst werden: Denn in der Medienlandschaft der heutigen Bundesrepublik wird der promovierte Jurist oft nur auf zwei Wendungen reduziert.
Reduktion auf zwei Schlagworte
Zum einen haben wir da den „gärigen Haufen“. So bezeichnete Gauland einst „seine“ AfD, der er – als Mitbegründer der Wahlalternative 2013 – von Anfang an dienend und inspirierend zur Seite stand. Gemeint war damit grob: Die AfD ist eine junge Partei, es gehe drunter und drüber, der basisdemokratische Impuls und das widerborstige Grundelement sorgen für viele geschlagene Schlachten und zahlreiche Neusortierungen der Lage; alles bleibt offen, volatil, fluide. Gauland hätte hierbei auch Victor Adler zitieren können, der einst proklamierte: „Ein Haufen unzufriedener Menschen ist noch keine Partei.“ Der Mitbegründer der österreichischen Sozialdemokratie wusste, dass eine jede erfolgssuchende Partei geordnet, diszipliniert, organisiert werden müsse. Gauland half mit, diese Adlersche Herausforderung für die AfD, soweit es überhaupt möglich war und ist, zu bewältigen.
Zum anderen haben wir den „Vogelschiss“. Gauland wollte verdeutlichen, in einer Ansprache an die konservative und rechte Jugend, dass die deutsche Geschichte so vielgestaltig, so reich, so schöpferisch gewesen sei, dass eine exklusive linke Verkürzung jener Geschichte auf die Zeit des Hitlerismus einer unangemessenen Lesart der Vergangenheit Vorschub leistete. Das Problem war: Gauland nannte die zwölf Jahre polemisch einen „Vogelschiss“ angesichts einer jahrhundertelangen Geschichte. Die linksgepolte Presse machte daraus eine Verhöhnung der NS-Gegner, eine Bagatellisierung, mindestens aber eine Relativierung.
Eine neue Selbstverortung
Alexander Gauland hat nun eine Schrift vorgelegt, bei der man davon ausgehen darf, dass die Verengung der Rezeption seines seit über sechs Jahrzehnten (!) andauernden politischen Tuns auf diese beiden Begriffe bzw. Wendungen eine motivierende Rolle gespielt hat, dieses Werk auch zu verfassen bzw. zu publizieren. Man spürt bei DDR. CDU. AFD. Ein wider Willen politisch bewegtes Leben, das kürzlich im traditionsreichen Leopold Stocker Verlag zu Graz erschienen ist, jedenfalls an, dass Gauland sich überaus unwohl fühlt, wenn er überwiegend mit dem „gärigen Haufen“ und dem „Vogelschiss“ assoziiert wird.
So legt er seine 60-seitige „Politische Biografie“ vor, die durch sechs Schlüsselaufsätze bzw. Reden ergänzt und eingerahmt wird. Gauland, und dies wird dem Leser auf jeder Seite der konzisen autobiografischen Notizen deutlich, will erklären, was er tat, wie er es tat und warum er es schließlich tat. Es ist, ohne in Larmoyanz zu verfallen, mithin auch eine Rechtfertigungsschrift für sein eigenes Engagement, das ihn schließlich zum heutigen Ehrenvorsitzenden der Alternative für Deutschland machen sollte.
Vom Osten in den Westen – und zurück
Gauland ist dabei ein Ost-West-Ost-Wanderer. Geboren in der damaligen „Reichsindustriestadt“ Chemnitz, erlebte er 1944 und 1945 die angloamerikanischen Bombenangriffe auf die schutzlose Stadt, dann den Einmarsch der Roten Armee in einer nahegelegenen Kleinstadt im Frühjahr 1945. Seine Schulzeit verbrachte der Sohn des ehemaligen Chemnitzer Polizeipräsidenten, der früh verstarb – Alexander Gauland war da zehn Jahre alt –, in der „Zone“, wo er auch das Abitur ablegte. Über seine Schulzeit in der DDR resümiert Gauland, dass viel gelernt und leistungsorientiert erzogen wurde. Und: „Natürlich war da immer der ideologische Überbau, doch anders als heute blieben Fakten immer noch Fakten, und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es mehr als zwei Geschlechter geben könnte.“
Dennoch: Dem Realsozialismus verfiel er nicht. Vielmehr fand er seine erste große Liebe im britischen Radiosender BBC, den er täglich konsumierte. „Dass man dabei“, so konkludiert Gauland selbst gut gramscianisch, „automatisch der englischen politischen Kultur nahekam, versteht sich von selbst.“ Diese angeeignete Anglophilie prägte ihn, sein Denken und seinen Habitus, zeit seines Lebens. Sie war indes nicht der ausschlaggebende Grund, nach der Schulzeit die DDR zu verlassen. Vielmehr peinigte ihn, der hätte studieren können, die realistische Befürchtung, er müsse vorher noch eine Art Pflichtjahr im Braunkohletagebau absolvieren. Das wollte er nicht, und so landete er in Hessen, wo er in Marburg bei der sozialistischen Koryphäe Wolfgang Abendroth und dem weniger bekannten Gerhard Hoffmann studierte.
Frankfurter Jahre und konservative Prägung
Er trat dann dort, ausgerechnet in der Hochburg des orthodoxen intellektuellen Marxismus, der CDU und ihrer Studentenvereinigung RCDS bei, bevor er seine erste Tätigkeit als Pressereferent des westdeutschen Generalkonsulats in Edinburgh antrat. Danach agierte er auf verschiedenen christdemokratischen Posten in Hessen im Allgemeinen und in Frankfurt am Main im Besonderen. Diese „Frankfurter Jahre“ bezeichnet er als „die fruchtbarsten und erfolgreichsten in meinem politischen Leben“. Leser werden sich an Anekdoten zu Ernst Jünger und Jürgen Habermas erfreuen.
1991 dann, nach dem politischen Scheitern seines Mentors Walter Wallmanns, des hessischen Ministerpräsidenten von 1987 bis 1991, ging Gauland nach Brandenburg, um dort im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ihr gekauftes Ostpendant Märkische Allgemeine Zeitung zu leiten. In Potsdam wirkte er, der den Westen wieder in seine östliche Heimat verließ, von 1991 bis 2005 auf diesem Posten. In diesem Zeitraum veröffentlichte er auch seine wiederholt neu aufgelegte Schrift Anleitung zum Konservativsein. Parteipolitisch wollte er den „Berliner Kreis“ der Union anleiten, doch gelang dies nur beschränkt, was eine andauernde Entfremdung Gaulands von „seiner“ Partei in Gang setzte. Dieser Prozess mündete in der eingangs erwähnten Wahlalternative 2013 und im Aufbau jener AfD, von der Gauland schreibt, dass sie sich noch „heute in einem flüssigen Aggregatzustand befindet“. Da ist er nun doch wieder, der „gärige Haufen“.
Vom Journalisten zum Parteigründer
Die letzten 15 Seiten dieses politisch-biografischen Abrisses dürften dann zu einigem höflichen, aber bestimmten Widerspruch führen. Da gibt es diverse Kleinigkeiten: Zum Beispiel sei „Björn Höcke gerichtsnotorisch ein Faschist“, was nicht stimmt. Ein Gericht hat lediglich erlaubt, Höcke im Rahmen der polemischen Debatte eben auch so zu titulieren. Da gibt es aber auch gröbere Aspekte, die bereits in einem kürzlich veröffentlichten NZZ-Podcast angeschnitten wurden: Gauland bewertet die Rolle der AfD mittlerweile anders als das Gros der Wähler und das Gros der Mitglieder. Für ihn liege die Aufgabe der AfD darin, ein „Stachel im Fleisch der Regierenden“ zu sein. Das ist viel zu wenig, das ist (fast) nichts. Im Jahr 2025, wo die AfD bundesweit die 26-Prozent-Marke überschritten hat, muss sie angesichts des Vorschussvertrauens von Millionen Deutschen eine Alternative dem Wortsinne nach sein, nicht nur ein situatives Korrektiv für eine Post-Merkel-Union. Gauland, und das wird auf diesen Seiten überaus klar, hadert hingegen grundsätzlich mit dem großen Anspruch, eine echte „Alternative“ zu sein.
Er möchte keine kategorisch andere Politik, keine andere Gesellschaft, noch nicht einmal eine andere Form der Westintegration und NATO diskutieren, sondern Korrekturen am Linksruck der Union, und ebendies versucht er der NZZ und seinen Buchlesern ins Bewusstsein zu hämmern. Die grundlegenden Prinzipien der Union, ob bei der atlantischen Selbstverpflichtung oder beim Volksbegriff, vertritt er dabei noch heute; „Merkel“ steht bei ihm als Symbol für die unberechtigte Abweichung einer vermeintlich berechtigten Parteilinie. Es verwundert denn auch nicht, dass er als bundesdeutscher Grandseigneur des Konservatismus – der Grandseigneur des Rechts-Seins war eher Franz Schönhuber – den Begriff „rechts“ an sich überhaupt nicht mehr für zu retten hält.
Ein konservativer ohne Revolution
Dieser sei nicht mehr „nutzbar“, da er „untrennbar mit der Faschismuskeule verbunden“ sei. Eben dies wird gerade europaweit widerlegt, nicht zuletzt in Deutschland, wo Mitteforscher aller Couleur und jedes Instituts eine große Links-rechts-Polarisierung wahrnehmen, die ganz offensichtlich ein „Comeback“ des rechten Denkens und Fühlens mit sich bringt. Damit kann dieser alte (ohnehin nie abgeschlossene) Deutungskampf als fundamental neu eröffnet gelten.
Gauland warnt aber nicht nur vor dem Bekenntnis zu einer rechten Weltanschauung und einer daraus resultierenden Politikauffassung. Er warnt implizit sogar vor dem Ansinnen, dieses Land und sein Volk für größere Reformziele zu mobilisieren. Geht es nach Gauland, ist nur wenig möglich. Mit einem eher zu einem anderen Aspekt gehörenden Bismarckzitat sekundiert er seine Argumentation wie folgt: „Man kann keinen Strom aufhalten, viel weniger versuchen, gegen ihn zu schwimmen, man muss vorsichtig steuernd mit ihm fahren.“ Das erscheint viel zu defensiv angesichts der Lage, die wir in Deutschland, Österreich und Europa vorfinden. Linke und linksliberale Meta- und Realpolitik sind nicht der Strom, der vermeintlich unaufhaltsam in eine bestimmte Richtung fließt. Dies so zu verstehen, dies so zu verinnerlichen, und dies vor allem so seinen Mitstreitern mitzugeben, war und ist vielmehr essenzieller Teil des ureigenen charakteristischen Problems der Christdemokratie seit Anbeginn.
Das Erbe der Christdemokratie
Die Schwarzen in Bund und Land hecheln, auf Basis exakt dieser Prämisse handelnd, nicht erst seit der Merkel-Ära dem sukzessive nach links gerückten Mainstream hinterher und wollen nur symbolische Korrekturen – vorsichtig, zumal – vornehmen. Sie ermöglichen und zementieren so die Hegemonie des Falschen bis heute. Sie haben keine eigenen Ideen, keine eigene Weltanschauung, keine eigene Kampfeslust, keine eigene Hegemonietheorie (geschweige denn eine Hegemoniepraxis) – und machten so die Alternative für Deutschland für Teile dieses Volkes überhaupt erst notwendig. Diese christdemokratische Denkweise des zögerlichen und vorsichtigen Korrigierens in den dynamischen alternativ-blauen Aufbruch hineinzutragen, erscheint meta- und realpolitisch gleichermaßen wenig hilfreich.
Stark ist hingegen wieder der Abschluss des Bandes, wo Gaulands Hamburger Rede aus dem Dezember 2024 abgedruckt wird. In dieser wird deutlich, dass der große Connaisseur von Diplomatie und Weltpolitik sein Augenmerk stärker denn je auf die großen globalen Fragen lenkt. Glaubt man der Chemnitzer Freien Presse, arbeitet Gauland bereits an seinem nächsten Buch über derlei Themen. Man freut sich schon jetzt darauf.
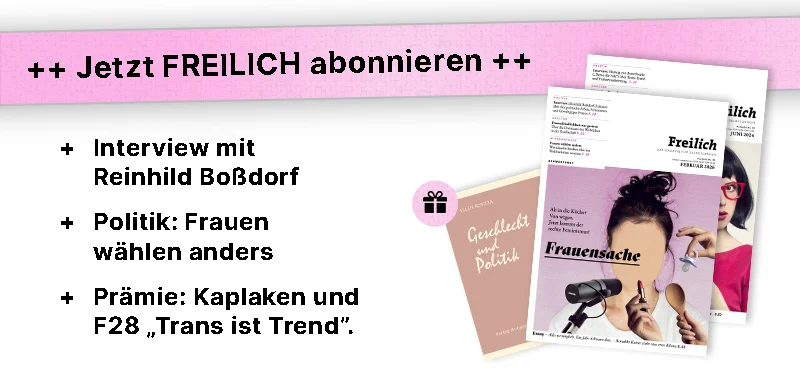




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!