Vor wenigen Tagen verkündete die Ex-AfD-Chefin Frauke Petry die Gründung einer neuen Partei. Nach zahlreichen gescheiterten Projekten soll es nun also ein weiterer Versuch sein, der die vermeintliche Lücke zwischen Union und AfD im politischen Mitte-Rechts-Raum schließen soll. Petry besteht nun aber darauf, dass diese Lücke nicht mehr nur mit den Koordinaten des bestehenden Links-Rechts-Spektrums zu definieren wäre, sondern anhand der Dichotomie „Etatistisch vs. Freiheitlich“ zu suchen sei. Fundamental neu oder gar politisch-revolutionär ist dieser Ansatz nicht. Es ist Ausdruck einer politischen Nische, die mit steigendem Erfolg der Alternative für Deutschland immer auch nach politischen Vehikeln und Freiräumen sucht, über die man ein autonomes und eigenständiges libertäres Projekt aufbauen kann.
Es herrscht seit Jahren in diesen libertären Zirkeln die eigentümliche Vorstellung, dass man lediglich die freiheitlichen Kräfte bündeln müsse, die staatliche Versorgungsstrukturen infrage stellen und Privatisierungen radikal vorantreiben.
Milei als Vorbild?
Insbesondere die internationale Resonanz und Popularität des Wahlerfolges des argentinischen Präsidenten Xavier Milei oder der durch Elon Musk neu geschaffenen US-Bundesbehörde „DOGE“ verstärken das Argument einer vermeintlichen Nachfrage für ein libertäres Parteiprojekt in Deutschland. Dabei werden insbesondere am Beispiel von Argentinien und Milei fundamentale Differenzen in den Wählermilieus und den Mentalitäten außen vor gelassen.
Argentinien befindet sich seit Jahren in einer chronischen Wirtschaftskrise. Hyperinflation, institutioneller Stillstand und massive Schuldenberge. Milei verspricht mit seinen radikal-disruptiven und deregulierenden Ansätzen einen Ausstieg aus der Dauerkrise. Die Hoffnung ruht dabei auf mehr Aufstiegschancen durch die Zugänge zur Globalisierung und zu freien Märkten.
Die Erwartungen der Deutschen
Das Erwartungsbild der deutschen Wähler ist jedoch nach wie vor auf ein wohlfahrtsstaatliches Versprechen mit hoher systemischer Stabilität ausgerichtet. Globalisierung und freie Märkte werden hierzulande eher als Bedrohung und Kontrollverlust wahrgenommen. Milei verkauft die Globalisierung als Aufstiegschance aus der Armut, während sie in Europa eher durch „Verlustnarrative“ geprägt ist.
In Argentinien besteht historisch eine größere Akzeptanz für politische Inszenierung, charismatische Führer und ein individualistisches Selbstverständnis, worüber sich libertäre Ideen anschlussfähiger verkaufen lassen. Milei ist ein Produkt spezifisch argentinischer Umstände – eines dysfunktionalen Staates, eines wirtschaftlichen Absturzes und einer völligen Delegitimation der politischen Eliten. Globalisierung und Kapitalismus erscheinen dort nicht als Bedrohung, sondern als Hoffnungsanker.
Sicherheit schlägt Freiheit
Deutschland hingegen ist kulturell eher regel- und sicherheitsorientiert. Weder ideen- noch parteipolitisch gab es hier jemals eine größere libertäre Bewegung. Die Menschen haben hier ein anspruchsvolles Erwartungsbild an den Staat, welches dieser aktuell nicht einlösen kann. Die politische Frustration folgt hierzulande nicht einer radikalen Infragestellung der staatlichen Ordnung, sondern ihrer fehlenden Leistungsfähigkeit. Der Staat wird nicht per se als überflüssig, sondern als bevormundend, ideologisch und von der Normalbevölkerung entkoppelt wahrgenommen.
Nun mögen Libertäre einwenden, dass die fehlende Leistungsfähigkeit eine genuine Folge der Anwesenheit staatlicher Strukturen sei. Doch diese Position verkennt eben, dass kollektive Wahrnehmungen mehr Energie und Wirksamkeit entfalten als nur Ideen. Die dominierende deutsche Wahrnehmung lautet nicht „Der Staat ist überflüssig“, sondern: „Der Staat funktioniert nicht gut genug.“
Freiheit als Nischenthema
Der deutsche Durchschnittsbürger (egal ob progressiv oder konservativ) ist kein Libertärer. Selbst unter Leistungsträgern, Unternehmern und Selbständigen dominieren sicherheits- und ordnungspolitische Mentalitäten. Die Idee, dass individuelle Freiheit primär durch Abwesenheit des Staates entsteht, ist in Deutschland historisch wie soziologisch ein Randphänomen. Der politische Wunsch großer Teile der deutschen Bevölkerung ist nicht „mehr Eigenverantwortung“, sondern „mehr Schutz“ vor den unkontrollierbaren Zumutungen von Globalisierung und radikal befreiten Märkten. Der Motivationskern des AfD-Elektorats gründet sich wesentlich stärker auf einer kulturellen und nativistischen Komponente, in Form der Abwehr der unbegrenzten Massenmigration und weniger auf ökonomischen Entlastungs- oder Verteilungsfragen.
Der libertäre Freiheitsbegriff bleibt abgesehen von akademischen Debattierklubs, weitgehend bedeutungslos. Aus Sicht einer realistisch agierenden rechten politischen Kraft, die auf Mehrheitsfähigkeit, strukturellen Einfluss und kulturelle Anschlussfähigkeit zielt, ist die Idee einer erfolgreichen libertären Parteigründung nicht nur naiv, sondern potenziell schädlich. Sie verkennt die Struktur der deutschen Wählerschaft ebenso wie die psychopolitische Tiefenschicht unserer politischen Kultur und Historie. Und sie ignoriert, was die empirische Datenlage zu politischen Milieus, Protestwählerschaft und wirtschaftspolitischer Orientierung schon lange deutlich macht: Die deutschen orientieren sich stärker an einem staatlichen Schutz- als Freiheitsversprechen.
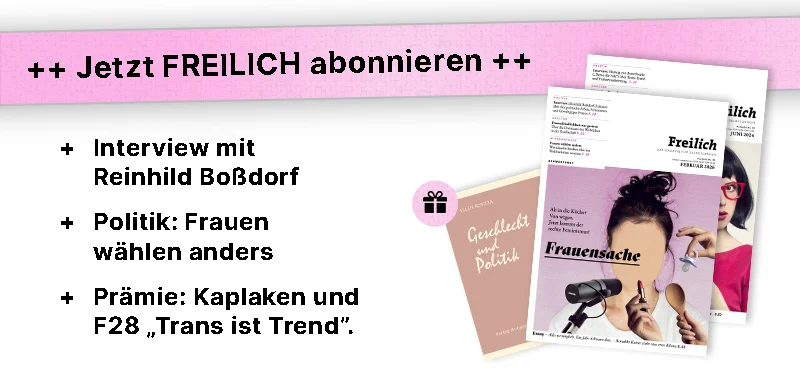




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!