Um exotische Kulturen kennenzulernen, muss man keine teuren Urlaubsreisen buchen – meist reicht bereits ein Ausflug in die Fußgängerzonen vieler europäischer Großstädte. Wer sich jedoch mit den Ausprägungen dieser geografisch und kulturell eher entfernten Bevölkerungsteile oder deren Geschichte befassen möchte, greift oft auf eines der etwa ein Dutzend großen Völkerkundemuseen im deutschsprachigen Raum zurück. Eines der bedeutendsten Museen dieser Art ist das Neue Grassi-Museum in Leipzig.
Das ursprüngliche Grassi-Museum am Wilhelm-Leuschner-Platz beherbergt heute die Leipziger Stadtbibliothek. Sie konnte durch das großzügige Erbe des italienischstämmigen Leipziger Kaufmanns Dominic Grassi (1801–1880) finanziert werden. Aufgrund von Platzmangel errichtete die Stadt in den 1920er-Jahren auf einem Platz zwischen der Prager Straße und der Dresdener Straße das Neue Grassi-Museum. Der im Laufe seiner Geschichte mehrfach rekonstruierte und sanierte, mehrflügelige Gebäudekomplex beherbergt heute neben dem Museum für Völkerkunde auch das Museum für Angewandte Kunst und das Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig. Eine Institution mit Renommee und Tradition also, die für Besucher und Einwohner ein bekanntes Ausflugsziel ist.
Von Weltkunst zur Schulderzählung
Im Zuge der neuen Ausstellung „Reinventing Grassi.skd“ möchte das Museum seit 2022 seinen Umgang mit den Exponaten aus aller Welt grundlegend ändern. Bei einer Sammlung von über 200.000 Objekten aus Afrika und Asien sind die Möglichkeiten der Gestaltung und Ausrichtung der Ausstellungen nahezu grenzenlos. Allein die zweitgrößte Kamerun-Sammlung Deutschlands macht das Museum zu etwas Besonderem. Es gehört nach einer Fusion mit Standorten in Dresden und Herrnhut zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. In einem solchen Kontext jedoch weder eine euphorisierte Werbung formulieren noch eine ungewiss-interessierte Perspektive auf einen derartigen Prozess einnehmen zu können, gehört zu den traurigen Umständen der Gegenwart.
Für jeden, der es sehen will, ist die Vereinnahmung des Kulturbetriebs in Deutschland durch den linken Hegemon zu plump und zu deutlich, dessen Produkte im Jahr 2025 weder überraschen noch ernsthaft aufregen sollten. Während die Exponate selbst einen spannenden Einblick in fremde Welten ermöglichen, erfahren die Besucher durch die Begleittexte lediglich, wie schlimm ihre Vorfahren waren, wie grausam der „Raub“ der fremden Kulturgüter war und dass die Probleme von gestern und heute vor allem von den unbelehrbaren weißen Männern ausgehen.
Aktivisten inszenieren koloniale Schuld
Ein Beispiel ist die „Intervention des Künstlerkollektivs PARA“ zur Rückführung des Gipfelsteins des Kilimandscharo nach Tansania (ehemals Deutsch-Ostafrika). Dafür hat die Gruppe im Jahr 2022 die obersten sechs Zentimeter der Zugspitze entfernt und hält diese seitdem als metaphorische Geisel. Der Gipfelstein wurde 1889 durch den Geographen und Erstbesteiger Hans Meyer (1858–1929) in dessen Heimatstadt Leipzig gebracht und später zur Hälfte Kaiser Wilhelm II. geschenkt; die andere Hälfte gehört heute einem Sammler aus Österreich.
Die Stoßrichtung ist klar: Der Kolonialist Meyer raubte den Einwohnern ein für sie elementar bedeutsames Stück Natur, und das Volk Tansanias wird nicht eher ruhen, bis es wieder in dessen Besitz ist. Es ist zu vermuten, dass sich weder der Großteil der deutschen noch der tansanischen Bevölkerung des Fehlens eines Gipfelsteins auf dem Kilimandscharo oder der Geschichte seines Verschwindens bewusst ist. Für uns sollte es ein enormes Problem darstellen, wenn eine internationale Gruppe antiweißer, antieuropäischer und vor allem antideutscher Aktivisten gegen unsere Kultur und unsere Geschichte auf dem Trittbrett des Schuldkultes vorgeht.
Ideologie statt Wissenschaft
In diesem Kontext sind die „Queerfeministischen Geschichten aus dem Königreich Benin“ in Form einer Faltbroschüre mit einer erschlagenden Textwand oder die Gestaltungsfläche „Feminismus für alle“ samt karikaturhafter One-World-Menschen nur folgerichtig. Man vermisst Hinweise auf die positiven Leistungen von Deutschen in den Kolonialgebieten, die wissenschaftliche Bedeutung der nach Europa gebrachten Güter für das Verständnis und den Erhalt fremder Kulturen sowie das Schicksal der ehemaligen Kolonien nach der Abtrennung von Deutschland. Letztlich erfüllt die Ausstellung mit dem Vehikel des Antikolonialismus jedoch eine andere Funktion, wie auch der US-amerikanische Politologe Bruce Gilley in seinem Buch „Verteidigung des deutschen Kolonialismus“ resümiert.
„Die Debatte über den deutschen Kolonialismus existiert nicht in einem akademischen Vakuum, sondern hat direkten praktischen Bezug zu einer Reihe drängender politischer Fragen. Deshalb geht es dabei um mehr als nur eine abstrakte akademische Debatte. Es steht viel mehr auf dem Spiel, da verzerrte Geschichtsbilder instrumentalisiert werden, um eine Reihe radikaler politischer Forderungen zu Themen wie Migration, Entwicklungshilfe, Handelspolitik, Klimawandel, Verteidigung, globaler Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, politischen Systemfragen und der Globalisierung zu untermauern. […] Wenn die Deutschen nicht beginnen, die Verleumdungen und Verzerrungen ihrer großartigen kolonialen Errungenschaften zu hinterfragen, werden sie noch Jahrzehnte dafür zu büßen haben.“
Wer sich also nicht explizit um eine Gegendarstellung bemühen möchte, der kann nur eines machen: Die Ausstellungen des Grassi-Völkerkundemuseums ausnahmslos meiden, bis man in Leipzig mit der schamlosen Selbstbeschädigung der Vergangenheit der eigenen Forscher, des Museums und Deutschlands aufgehört hat.
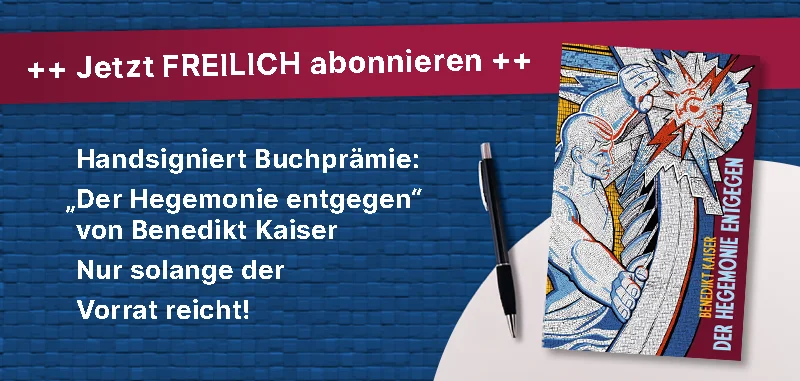
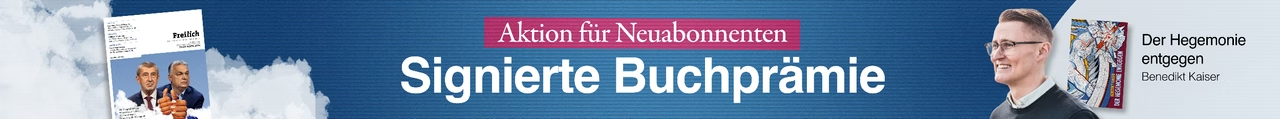

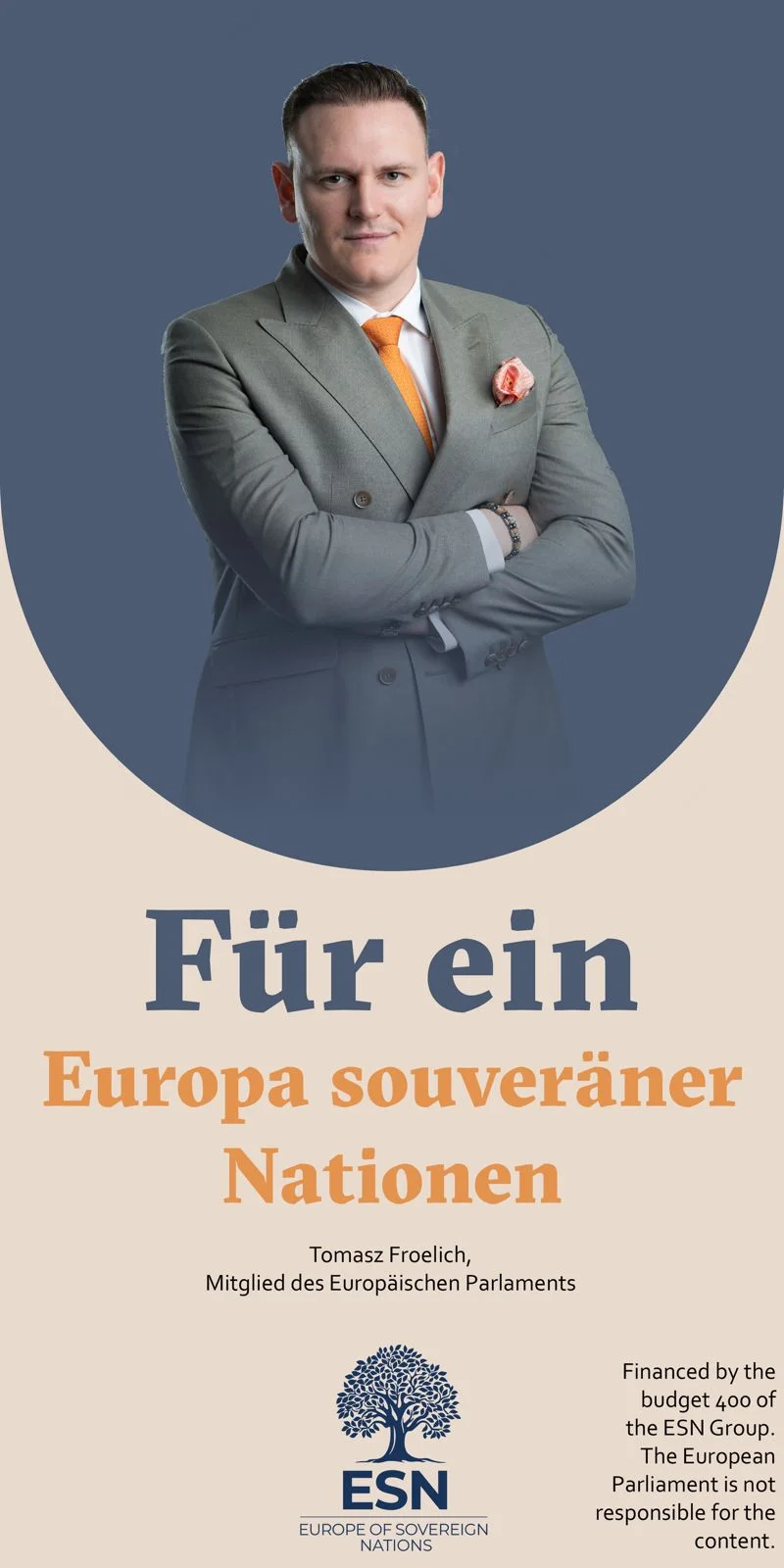

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!