„Warum tun wir uns das alles an?“ Diese rhetorische Frage einer Mutter, die ihr Kind auf die Gräfenauschule in Ludwigshafen-Hemshof schickt, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Die Grundschule machte bundesweit Schlagzeilen, weil über 40 Schüler eines Jahrgangs sitzengeblieben sind, 98 Prozent der Schülerschaft hat einen „Migrationshintergrund“, zumeist einen orientalischen. Die AfD-Fraktion setzte das Thema auf die Tagesordnung des Bildungsausschusses des Landtags und befragte Kultusministerin Stefanie Hubig (SPD) im Plenum zur Gesamtsituation. Hubig konnte zwar nicht bestätigen, dass Lehrer in Türkisch und Albanisch unterrichteten, gleichwohl wolle man am sogenannten Herkunftssprachenunterricht festhalten. Der Steuerzahler finanziert tatsächlich über 35 Wochenstunden dieses Unterrichtes, darunter Arabisch und exotische Idiome.
Müll, tote Tiere und Uringestank
Hubig vertrat auf meine konkrete Frage hin die Auffassung, dass vier Stunden Deutsch-Förderunterricht nicht nötiger und sinnvoller seien als vier Stunden Herkunftssprachenunterricht. Das sei „wissenschaftlich erwiesen“. Auf der Internetpräsenz der Gräfenauschule lassen sich keine Angaben zu ihrer Geschichte finden. Wozu? Sie ist heute, zuspitzend formuliert, nur mehr eine Verwahranstalt, ein „Hotspot“ des multikulturellen Experiments, welches der Politikwissenschaftler Yascha Mounk verheißungsvoll als „in der Geschichte der Migration einzigartig“ beschrieb.
Ortstermin im Hemshof: Vor vielen Häusern stapelt sich Sperr- und Hausmüll, tote Tauben und Ratten liegen in den Beeten, an vielen Ecken stinkt es. Nach Urin, nach fremden Gewürzen. Die Mittagshitze flimmert, bei fast allen Häusern sind die Rollladen heruntergelassen. Aus vielen dröhnt primitiver Rap oder orientalische Weisen. Es ist kurz vor Zwölf.
In Hemshof dominiert das Beziehermilieu
Die Fassaden der Bürgerhäuser künden von einer Kultur, die nahezu verschwunden ist – die deutsche, unsere. Viele ihrer Erbauer hatten im 19. Jahrhundert dezent, aber gut sichtbar Wappen, Hausmarken und Symbole über Tore, Türen und Fenster eingelassen, die den Besucher auf ansässige Gewerke, Betriebe und ihre Geschichte hinwiesen. Oder schlugen durch den architektonischen Stil vom Historismus bis zur Neurenaissance eine Brücke in eine Vergangenheit, an die man selbstbewusst anknüpfen wollte. Sie alle strahlten jene Würde aus, die auf der Gewissheit beruhte, einen veritablen Beitrag zu Gemeinwohl und Wohlstand, zum großen Ganzen zu leisten. Ein Lebenswerk zu hinterlassen, auf dem Nachfolger und Nachfahren aufbauen konnten.
Der Heiland hält seine schützenden Hände über einen gefallenen jungen Soldaten. Er ist nackt, der Stahlhelm, den das kaiserliche Heer dem Schaller des Spätmittelalters nachempfand, und ein kurzes Schwert weisen ihn als Krieger aus. Das Denkmal, das den im Ersten Weltkrieg gefallenen Söhnen des Hemshofes gewidmet ist, taucht in den offiziellen Übersichten der Stadt nicht mehr auf. In seiner Nähe steht das alte Postgebäude, über seinem Tor prangt der Reichsadler. Er breitet seine Schwingen aus. Die Architektur des repräsentativen Verwaltungsbaus, der 1925 errichtet wurde, spielt mit expressionistischen Elementen. Selbst ein Postamt schien dem damaligen Zeitgeist nicht zu profan, um es auf diese Weise mit staatlichen Insignien auszustatten. Beide sind steinerne Zeugen einer Kultur und Geisteshaltung, die förmlich abgebrochen ist. Heute dominiert im Hemshof die staatliche Alimentierung, es hat sich ein Beziehermilieu herausgebildet und verfestigt, in dem man normale Erwerbsbiografien mit der Lupe suchen muss. In den Worten eines Kindes, das wir in ein Gespräch verwickelten: „Papa kann nicht arbeiten, er muss Kinder machen“.
Deutsche werden verdrängt
In Hemshof haben längst Verdrängungsprozesse gegriffen: Italiener und Griechen zogen – halb freiwillig, halb erzwungenermaßen – weg, Türken, Araber und „Bulgaren“ prägen nun das Viertel. Als wir gegen Eins durch den Hemshof spazieren, liegen einige der „Bulgaren“ in ihren Autos und dämmern vor sich hin. In dem Café, das in der Nähe des „Irakischen Kulturvereins“ und einer Hinterhofmoschee liegt, spricht die Bedienung kein Wort Deutsch. Als wir eine Bestellung aufgeben, schaut sie uns irritiert an. Im Hemshof existieren zwei Welten nebeneinander, die flüchtige deutsche und die stark wachsende migrantisch-orientalische. Von ersterer kündet das „Prinzregententheater“, ein pfälzisches Mundarttheater, dessen Institution und Spielplan von Jahr zu Jahr skurriler anmutet. Eine Zukunft hat es nicht.
Der Supermarkt in seiner Nähe kommt nicht ohne „Security“ aus, vor dem Eingang knien aggressiv fordernde Bettler. Im Jahr 2016 bekritelte die SPD-nahe Rheinpfalz, die „soziale Mischung“ stimme nicht mehr. So kann man diese soziodemographischen Verwerfungen natürlich auch beschreiben. Seitdem sind weitere sieben Jahre ins Land gezogen. Der Zuzug in unser Land geht unvermindert weiter. Die offiziellen Aufzeichnungen sind eindeutig: Im letzten Jahr sind mehr Menschen nach Deutschland eingewandert als jemals zuvor.
Dann treffen wir einen der letzten Deutschen im Hemshof. Der Mann hat Jahrzehnte bei der BASF malocht. Arbeiter, SPD-Wähler. Als er in die Gräfenauschule ging, war sie eine Bildungsanstalt, die zuverlässig dafür sorgte, dass junge Hemshofer ihren Weg durchs Leben fanden und von ihrer Hände Arbeit leben konnten. Viele stiegen auf. Wurden Arbeiter, leitende Angestellte, Handwerker und Unternehmer. So wie der Mann, der uns Bilder seiner Schulzeit zeigt. Er wirkt verzweifelt. „Die Politik hat uns vergessen“, sagt er. Überall liege Müll, es sei üblich, ihn aus Fenstern auf die Straße zu werfen, es kümmere keinen „da oben“. Die Deutschen hier seien nur noch geduldet, isoliert, immerhin zahlten sie pünktlich Steuern. Er könne nicht wegziehen, andere Viertel seien zu teuer. Dann weint er.
Vor zwanzig Stunden hat in Nürnberg ein evangelischer Kleriker mit Afro-Frisur in die Menge gerufen: „Wir schicken ein Schiff und noch viele mehr“. Die Kirchentagsbesucher jubeln ekstatisch. Sie leben in anderen Vierteln.
Zur Person:
Joachim Paul ist Abgeordneter für die AfD im Landtag Rheinland-Pfalz. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Bildungs- und Digitalpolitik.
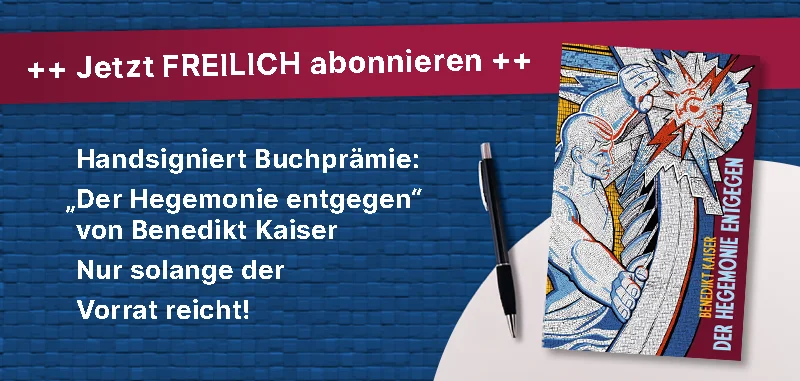




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!