Das Phänomen „Antifaschismus“ ist etwa 100 Jahre alt. Seine Wurzeln liegen in der kommunistischen Bewegung, die sich nach dem ersten Weltkrieg und der Etablierung eines eigenen Staates auf russischem Boden dem Sprung zur Weltrevolution nahe wähnte. Diese Weltrevolution sollte die sozialen, religiösen und kulturellen Unterschiede der Menschheit nivellieren. Das Eigentum an Produktionsmitteln, also das private Unternehmertum, sollte abgeschafft und die Macht traditioneller Religion im Alltag weitgehend zurückgedrängt werden. Zudem sollte durch die Überwindung der nationalen Unterschiede eine Weltgemeinschaft der Proletarier vorbereitet werden, an deren Ende eine neue menschliche Entwicklungsstufe ohne Ausbeutung, Entfremdung und Krieg stünde. Natürlich war das Konzept Kommunismus von Anfang an nicht auf Freiwilligkeit, demokratische Prinzipien oder offenen Diskurs festgelegt, sondern auf die Komponente Gewalt zur Erreichung seiner Ziele. Aus diesem Grund entstand auch Widerstand von bürgerlicher Seite, der nach dem ersten Weltkrieg in zunehmend radikalere Strömungen mündete. Mit den in der Zwischenkriegszeit aufkommenden autoritären und totalitären Massengruppierungen wurde diese Gegenbewegung militant. Ein für die Kommunisten ernst zu nehmender Gegner entstand, den sie wiederum mit einer „antifaschistischen“ Strategie zu bekämpfen trachteten.
Die nationalistisch ausgerichteten Massenbewegungen der Zwischenkriegszeit sind also als Reaktion auf den kommunistischen Machtanspruch zu bewerten. Jener war, der marxistischen Ideologie entsprechend, weltumspannend, also die staatlichen Grenzen überschreitend. Deshalb sollte die 1919 gegründete „Kommunistische Internationale“ (Komintern) dazu dienen, die kommunistischen Parteien in den unterschiedlichen Staaten logistisch zu vernetzen und zu einer „Weltkirche“ zusammen zu schließen. Die heute noch gebräuchliche Verwendung des Begriffs „Faschismus“ für unterschiedlichste rechtsgerichtete und autoritäre Systeme hat hier seinen Ursprung. Die zugehörige Definition lieferte der spätere Komintern-Generalsekretär Georgi Dimitroff 1924 und dann nochmals 1933 und schließlich 1935, indem er den Faschismus als die „terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ bezeichnete. Zugleich wurde – ganz gemäß der Logik marxistischer Geschichtsphilosophie – der kleinbürgerlich geprägte „Faschismus“ als Teil der Niedergangsphase des Kapitalismus bewertet, die von der Diktatur des Proletariats folgerichtig abgelöst würde.
Als Unterorganisation der Komintern wurde 1923 die „Antifaschistische Weltliga“ gegründet. Doch diese existierte nur ein Jahr, da es bald zu Zentralisierungsbemühungen der sowjetischen KP kam. In diesem Zusammenhang wurde in der nun kurzzeitig aufkommenden „Sozialfaschismus“-These vorerst der sozialdemokratische Gegenspieler der Kommunisten als Hauptfeind definiert.
Die „Sozialfaschismus“-These wurde nach der NS-Machtergreifung fallen gelassen, um „antifaschistische“ Bündnisse auch mit nicht explizit kommunistischen Gruppierungen schmieden zu können. Der Komintern-Vertreter Willi Münzenberg war der maßgebliche Urheber des nach 1933 gegründeten „Weltkomitees gegen Krieg und Faschismus“ (WKKF), das Kampagnen gegen das NS-System initiierte. Durch diese moralisch unterfütterte Propaganda konnten über die kommunistischen Kader hinausreichende linksbürgerliche Adressaten erreicht werden. Wie flexibel die Kommunisten die „Antifaschismus“-Doktrin allerdings handhabten, zeigte sich, als sie diese nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 wieder in die Schublade wandern ließen und nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 wieder hervorholten. Diese elastische Nutzung des „Antifaschismus“-Narrativs zur Legitimierung und Absicherung eigener Macht sollte sich fortan bis in die Gegenwart fortsetzen.
Antifaschismus nach 1945
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden lokal „Antifaschistische Aktionsausschüsse“ gegründet, deren Ziel das Verbot sämtlicher institutioneller Überbleibsel des NS-Systems und „faschistischer Propaganda“ sowie die Bestrafung ehemaliger NS-Anhänger war. Die schrittweise Wiederherstellung bürokratischer Strukturen und der Aufbau von Parteien durch die alliierten Militärmachthaber entzog diesen wilden, demokratisch nicht legitimierten „Ausschüssen“ aber schließlich die Machtgrundlage. „Antifaschistische“ Rhetorik fand sich allerdings auch in den neu gegründeten Parteien der Nachkriegszeit, etwa der frühen CDU, die sich teils für einen „christlichen Sozialismus“ einsetzte. War der bürgerliche „Antifaschismus“ dabei eher moralisch unterfüttert, so lag beim kommunistischen „Antifaschismus“ der Fokus klar auf dem Ziel der Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Unter dem Einfluss des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher und des CDU-Kanzlers Konrad Adenauer wurden diese unmittelbaren Nachkriegstendenzen zugunsten der „antitotalitären“ Vorstellung einer „wehrhaften Demokratie“ abgelöst, die sich gegen „Extremismus von links und rechts“ zu wenden habe.
Während in der DDR der „Antifaschismus“ zur Staatsdoktrin wurde, die die Herrschaft der kommunistisch dominierten „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ (SED) legitimieren sollte, führte der „Antitotalitarismus“ in Westdeutschland zu zwei Parteiverboten. Mit den Verboten der NS-nahen SRP 1952 und der KPD 1956 wurden Schläge „gegen rechts und links“ geführt. Das KPD-Verbot hatte den Effekt, dass deren Anhänger in mehrere Tarn- und Vorfeldorganisationen auswichen. Als eine bot sich die in den 1940er-Jahren aus der Taufe gehobene „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) an, die durch ihren scheinbar moralisch unverfänglichen Namen auch linksbürgerliche Personen als Bündnispartner ansprechen wollte. Als ihr Symbol wählte die VVN den roten Winkel, der in den Konzentrationslagern des NS-Systems das Kennzeichen politischer Häftlinge war. Diese maßgeblich von der DDR finanzierte Gruppierung diente dazu, regelmäßig die nicht ausreichende Entnazifizierung in der Bundesrepublik anzuprangern, die christdemokratische Bundesregierung zu delegitimieren, ein „antifaschistisch“ ausgerichtetes Geschichtsbild mittels ausgiebiger Gedenkstättenarbeit durchzusetzen und die außenpolitischen Interessen der DDR zu fördern. Kurz: Es wurde mit Akribie vor dem stets drohenden Faschismus oder einer „Re-Nazifizierung“ gewarnt.
Vom „radikalen“ zum „aggressiven Antifaschismus“
Mit der 1968er-Bewegung wurde diese festgefahrene Situation zu Gunsten der Linken aufgebrochen. Nun wurde von den tonangebenden Teilen der akademischen Elite offen mit zahlreichen kommunistischen Systemen sympathisiert, ungeachtet der von jenen begangenen und öffentlich bekannten Massenmorde. Zum bisherigen „orthodoxen Antifaschismus“ der VVN, die sich 1971 aus Gründen der Verjüngung den Beinamen „Bund der Antifaschisten“ (BdA) gab, gesellte sich nun der „aggressive Antifaschismus“. Jener unterteilte sich zum einen in den „radikalen Antifaschismus“ der K-Gruppen. Das waren unterschiedliche kleine kommunistische Kadergruppierungen, wie der „Kommunistische Bund“ (KB), der „Kommunistische Bund Westdeutschland“ (KBW) oder die „Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten“ (KPD/ML).
Dem „radikalen Antifaschismus“ war eigen, zunehmend gezielt als „rechts“ identifizierte Einzelpersonen in regionalspezifischen Broschüren mit Fotos und Adressen zu brandmarken und teils offen zur Gewalt aufzurufen. Zum anderen entwickelte sich in den frühen 1980er-Jahren die zweite Unterart des „aggressiven Antifaschismus“: der „autonome Antifaschismus“. Aus der Anti-Atomkraft-Bewegung und der Hausbesetzerszene entstand eine linksradikale Subkultur, die nicht mehr auf die Organisation in Partei- und Vereinsstrukturen setzte, sondern lose regionale Gruppen bildete, die sich für gemeinsame Aktionen verabredeten. Als Treffpunkte und zur Rekrutierung von Nachwuchs dienten die in diesem Kontext in zahlreichen Gemeinden entstehenden „selbstverwalteten“, aber oft städtisch geförderten linken „Kulturzentren“. Gewalt war für den „autonomen Antifaschismus“ stetes politisches Mittel. Sie wurde entweder im Rahmen von Großveranstaltungen durch einen vermummten und uniformierten „Schwarzen Block“ ausgeübt, zum Beispiel bei den regelmäßigen Krawallen zum „Revolutionären 1. Mai“ in Berlin und Leipzig, oder im Rahmen „klandestiner“ Attacken gegen rechtsgerichtete Einzelpersonen.
1992 versuchten sich diverse regionale Gruppen des „autonomen Antifaschismus“ zu einem Zentralverband zusammenzuschließen, der „Antifaschistischen Aktion/Bundesweite Organisation“ (AA/BO). Dieser zerbrach 2001 allerdings wieder auf einem „Antifa-Kongress“ in Göttingen an den unterschiedlichen Positionen der pro-israelischen „Antideutschen“ und der pro-palästinensischen „Antiimperialisten“ zum Nahost-Konflikt.
Die AA/BO hatte für sich ein Symbol gewählt, das bereits seit den 1980er-Jahren in der Antifaszene allgemein gebräuchlich wurde. Es handelt sich um zwei in einem Kreis hintereinander gesetzte Fahnen, die eine rot, die andere schwarz. Das Symbol geht auf einen Entwurf des Grafikers Max Gebhard aus dem Jahr 1932 zurück. Gebhard hatte 1926/27 am Dessauer Bauhaus studiert. Der Architekt und Bauhaus-Gründer Walter Gropius hatte sich für Gebhards Stipendium eingesetzt. Nach dessen Auslaufen ging Gebhard aus finanziellen Gründen nach Berlin und arbeitete für eine amerikanische Werbefirma. Gebhard war gleichwohl schon während seiner Studienzeit in die KPD eingetreten und engagierte sich bei antifaschistischen Versammlungen. In Berlin nun übernahm er für die KPD auch gestalterische Aufträge und arbeitete mit dem Grafiker Max Keilson zusammen.
Keilson war Mitgründer der „Assoziation revolutionärer bildender Künstler“ und entwarf Propagandaplakate für die „Antifaschistische Aktion“ der KPD. Nach dem Krieg sollte er Leiter der Presseabteilung des Außenministeriums der DDR werden. Für eine „Kinderwoche“ der KPD, die der Rekrutierung von Nachwuchs dienen sollte, entwickelte Gebhard womöglich in Zusammenarbeit mit Keilson das Symbol mit den beiden Fahnen. Damals waren beide allerdings noch rot und standen für die Zusammenarbeit von KPD und SPD. Das Symbol fand damals seinen Weg auf Plakate, Flugblätter und Zeitungen. Diese Gestaltung wurde wohl in den späten 1970er-Jahren von Bernd Langer wieder aufgegriffen. Langer agierte seit 1977 in der sich entwickelnden „autonomen“ Szene Göttingens und war Mitinitiator der linksradikalen Kunst-Gruppe „Kunst und Kampf“ (KuK). Heute publiziert er in linken Medien wie der taz, der Jungen Welt oder dem Neuen Deutschland. Langer wählte statt der einst zwei roten Fahnen nun eine rote und eine schwarze, die jeweils Kommunismus und Anarchismus symbolisieren. Das Motiv hat seitdem je nach spezifischer Untergruppierung abgewandelte Formen hervorgebracht.
„Neo-Antifaschismus“ und „Kampf gegen rechts“
Zum „aggressiven Antifaschismus“, der bis heute die Verantwortung für zahlreiche Straf- und Gewalttaten gegenüber rechtsgerichteten Menschen trägt, gesellte sich ab Ende der 1980er der „Neo-Antifaschismus“. Diese Bezeichnung soll als Überbegriff für die langsame Fortentwicklung des „Antifaschismus“ aus den orthodox-kommunistischen und „autonomen“ Subkulturen hin zum Staatsprogramm dienen. „Antifaschistische“ Denkmuster wurden seit Ende der 1980er-Jahre zunehmend offen in gemäßigteren linken Kreisen formuliert, so bei den Jungsozialisten oder den Grünen, um dann schrittweise immer weiter in den linksbürgerliche Bereich vorzudringen. Hinzu kam eine immer stärkere Verankerung in der Kulturszene, vor allem bei Musikveranstaltungen, aber auch beispielsweise im Bereich der Kunstpädagogik.
Mit der Durchsetzung des „Neo-Antifaschismus“ zu Lasten des einst offiziell propagierten „Antitotalitarismus“ erfolgte die stete Ausweitung der finanziellen Mittel für Maßnahmen gegen „Rechtsextremismus“ und „rechte Gewalt“. Wissenschaftliche Stellen wurden geschaffen, Studien finanziert, pädagogische Einrichtungen erhielten Fördergelder.
Eine der zentralen Geldsammel- und Weiterleitungsstellen ist dabei die 1998 von der ehemaligen inoffiziellen Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane initiierte „Amadeu Antonio Stiftung“, die – typisch für den „Neo-Antifaschismus“ – zahlreiche linkspolitische Subaktivitäten entwickelt hat. Das reicht von der Mitorganisation von „Laut gegen Nazis“-Konzerten über finanzielle Hilfsfonds für Asylwerber bis zu diversen Veranstaltungen und Webauftritten oder neuerdings einer „Meldestelle Antifeminismus“. Daneben entdeckten die „zivilgesellschaftlichen“ Akteure des „Antifaschismus“ frühzeitig die Chance, durch Dominanz im Internet den Ruf oppositioneller Personen und Gruppen zu schädigen. Negativ selektierte Meldungen und Halbwahrheiten werden seitdem von anonymen Autoren nicht nur bei Wikipedia gestreut. Eine „Privat-Stasi“, deren Geldgeber im Dunkeln bleiben, leistet auf diese Weise digitale Zersetzungsarbeit.
Dass sich der „Neo-Antifaschismus“ derart flächendeckend ausbreiten konnte, wurde durch zwei große Kampagnen geistig möglich gemacht. Zum Einen diente die sogenannte „Lichterketten-Bewegung“ 1991/1992 dazu, eine linke „Volksfront“ zu formieren und bürgerliche Gruppen mit in das Boot „gegen rechts“ zu zwingen. Die Bewegung, die es schaffte, mittels Konzerten und Kerzenzauber Hunderttausende in Großdemonstrationen gegen Ausländerhass auf die Straße zu bringen, war eine Reaktion auf die ausländerfeindlichen Anschläge von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen.
Einer durch den Mauerfall von 1989 konsternierten Linken gelang es mit ihrer Hilfe wieder, Geschlossenheit im Kampf gegen ein gemeinsames Feindbild, eine bürgerliche Massenbasis und die Kontrolle über den kulturellen Überbau zurück zu erlangen. Das Muster wurde knapp zehn Jahre später kopiert, diesmal mit sehr fadenscheiniger Begründung. Anlass war ein bis heute nicht geklärter anonymer Rohrbombenanschlag an einem Düsseldorfer S-Bahnhof im August 2000. Reflexartig wurde in den Medien eine „braune Flut“ dafür verantwortlich gemacht. „Antifaschistische“ Organisationen und Journalisten heizten die Stimmung an. Es kam zu zahlreichen von etablierten Politikern und Institutionen getragenen Aktionen und Massenkundgebungen „gegen rechts“. Dabei wurde deutlich, wie tief die „antifaschistischen“ Bilder und Wertungsmuster längst bei vielen Bürgern innerlich abgespeichert waren, so dass faktisch anlasslos auf Knopfdruck gewünschte Reflexe abgerufen werden konnten, die bis zu hysterischen Wahnreaktionen reichten. In diesem Klima rief am 4. Oktober 2000 der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einem „Aufstand der Anständigen“ auf. Das war das Stichwort, aus dem sich die künftige Freigabe hoher Millionenbeträge an Steuergeldern an zahlreiche linke Initiativen ableitete, die dafür nicht einmal formale Bekenntnisse zum Grundgesetz ableisten mussten. Der „Kampf gegen rechts“ wurde zu einer staatlichen Dauereinrichtung, die den einen dazu diente, die eigene Macht gegen Konkurrenz abzusichern und den anderen dazu, sich an der öffentlichen Wertschöpfung persönlich zu bereichern.
Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der FREILICH-Ausgabe 23 „Terror von links“.
Zur Person:
Claus-M. Wolfschlag, Jahrgang 1966, ist promovierter Historiker und als Journalist sowie Buchautor tätig. 2001 erschien sein Buch „Das ‚antifaschistische Milieu‘: vom ‚schwarzen Block‘ zur ‚Lichterkette‘“.
Letzte Buchveröffentlichung: „Linke Räume. Bau und Politik“ (2023, Verlag Antaios)
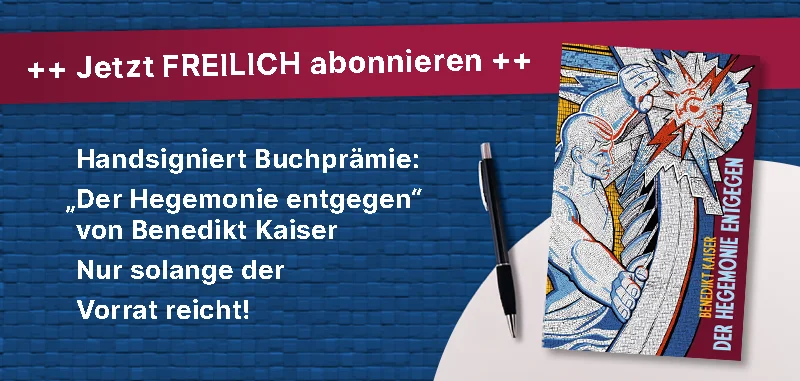




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!