Kritik an Unternehmenssteuern ist oft unpopulär und wird schnell als Lobbyismus abgetan. Doch die versteckten Auswirkungen dieser Steuern auf Arbeitnehmer, Verbraucher und kleine Unternehmen sind erheblich. Studien des ifo Instituts und des NBER zeigen, dass 31 Prozent der Unternehmenssteuerlast auf höhere Preise für Verbraucher abgewälzt werden, 38 Prozent auf niedrigere Löhne für Arbeitnehmer und nur 31 Prozent auf Anteilseigner. Eine Erhöhung des Unternehmenssteuersatzes um einen Prozentpunkt kann die Einzelhandelspreise um 0,17 Prozent steigern, was vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen belastet.
Unternehmensbesteuerung schadet den Arbeitnehmern
Höhere Unternehmenssteuern reduzieren insbesondere die Löhne von geringqualifizierten Arbeitnehmern, Frauen und jungen Beschäftigten und beeinträchtigen die Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass höhere Unternehmenssteuern die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die Anzahl und Qualität der Patente sowie die Beschäftigung von Forschern verringern.
Wirtschaftlich betrachtet sind Unternehmenssteuern wachstumshemmend. Eine Studie des IWF zeigt, dass eine Senkung des Unternehmenssteuersatzes in Deutschland um zehn Prozentpunkte das BIP pro Kopf um 0,2 Prozent und das deutsche BIP insgesamt um 0,9 Prozent erhöhen könnte. In den USA führte die Senkung des Unternehmenssteuersatzes unter Präsident Trump zu einer Steigerung des BIP um 1,7 Prozent, und wird bis 2027 bis zu 340.000 neuen Arbeitsplätze schaffen.
Auch die globale Mindeststeuer ist ein Schritt in die falsche Richtung
Die globale Mindeststeuer betrifft große Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro und soll Steuermehreinnahmen von 5,1 bis 6,7 Milliarden Euro jährlich für die deutsche Regierung generieren. Sollte jedoch die Mehrheit der Niedrigsteuerländer ihre Steuersätze auf 15 Prozent erhöhen, werden die zusätzlichen Einnahmen auf zwei Milliarden Euro pro Jahr sinken. In Deutschland sind 827 Großunternehmen betroffen, die 40,5 Prozent des Gesamtumsatzes der deutschen Unternehmenslandschaft ausmachen.
Die globale Mindeststeuer verursacht einen weiteren erheblichen Verwaltungsaufwand. Zudem dämmt diese Regelung den internationalen Steuerwettbewerb und schwächt somit den bereits eh sehr angeschlagenen deutschen Standort. Finanzökonomen warnen, dass dies zu einem Subventionswettbewerb führen könnte, was bereits jetzt in Deutschland beobachtet werden kann.
Marktlandprinzip – ein gutes Instrument gegen Internetriesen
Das Marktlandprinzip zielt darauf ab, die Gewinne besonders großer und profitabler Konzerne nach dem Umfang ihres Absatzmarktes zu besteuern. Dies betrifft vor allem digitale Plattformunternehmen und Online-Marktplätze, da die Wertschöpfung zunehmend von immateriellen Aktiva abhängt. Die Umverteilung der Besteuerungsrechte soll einen Bruttogewinn von zehn Prozent übersteigenden und Residualgewinn betreffen, von dem ein Viertel vom Marktland besteuert werden kann.
Die Auswirkungen dieser Maßnahme auf die deutsche Wirtschaft sind begrenzt. Schätzungen des ifo Instituts zufolge betrifft diese Regelung weltweit nur 88 multinationale Konzerne, wovon nur sieben in Deutschland ansässig sind. Diese würden jährlich etwa 1,1 Milliarden Euro an zusätzliche Steuerlasten ins Ausland abführen müssen. Gleichzeitig könnten die zusätzlichen Staatseinnahmen in Deutschland bis zu 1,9 Milliarden Euro jährlich betragen.
Die unkontrollierte Macht globaler Konzerne übertrifft oft die Wirtschaftsleistung ganzer Länder. Amazon erzielte 2021 fast 400 Mrd. Euro Umsatz, vergleichbar mit dem BIP Österreichs, Apple 328 Mrd. Euro, vergleichbar mit Dänemark, und Alphabet 219 Mrd. Euro, mehr als das BIP Portugals. Große Digitalkonzerne wie Apple, Google und Meta investieren massiv in Lobbyarbeit in der EU. Die Marktlandbesteuerung erscheint daher als geeignetes Mittel, um ihre wachsende Macht und ihren Einfluss auf den Nationalstaat einzudämmen.
Fazit und Handlungsempfehlungen
Aus rechter Sicht ist eine Senkung der Unternehmenssteuern dringend notwendig, um Innovationen und Wirtschaftswachstum zu fördern und die versteckten Steuerbelastungen für Arbeitnehmer und Verbraucher zu reduzieren. Zudem muss Deutschland aus der globalen Mindeststeuer aussteigen, da sie den internationalen Steuerwettbewerb eindämmt, erhebliche Verwaltungsaufwände mit sich bringt und deutsche Industrieunternehmen maßgeblich belastet. Im Gegensatz dazu kann man den Ansatz der Marktlandbesteuerung digitaler Geschäftsmodelle befürworten, um die Gewinne aus digitalen Plattformen angemessen zu besteuern und die Macht dieser globalen Konzerne gegenüber dem Nationalstaat einzudämmen.
Zur Person:
Jurij Kofner ist gebürtiger Münchner und arbeitet als Ökonom beim Miwi Institut.
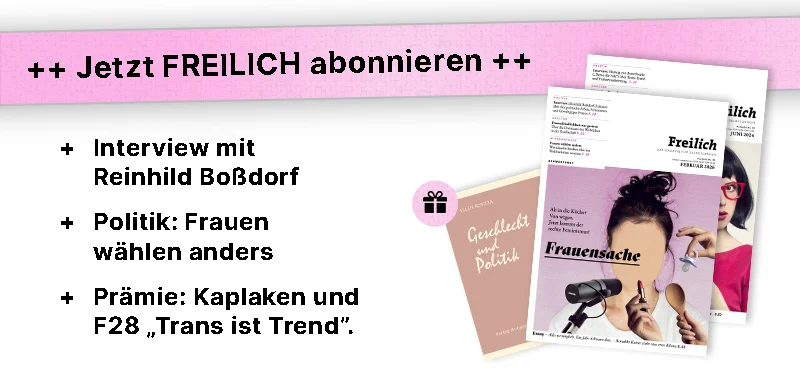



Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!