Im Jahr 1848 befand sich das deutsche Vormärz-Europa im Umbruch: Die Märzrevolution hatte im Deutschen Bund zu einem beispiellosen politischen Aufbruch geführt. Im Mai desselben Jahres wurde mit der Einberufung der Frankfurter Nationalversammlung erstmalig ein gesamtdeutsches Parlament etabliert, dessen Aufgabe in der Erarbeitung einer Verfassung für einen deutschen Nationalstaat bestand. Während in der Paulskirche liberale und nationale Hoffnungen aufblühten, wurde die Realität von äußeren Konflikten geprägt und blieb widersprüchlich. Ein zentraler Aspekt war der Deutsch-Dänische Krieg um die Herzogtümer Schleswig und Holstein.
Im August 1848 wurde der Waffenstillstand von Malmö zwischen Preußen und Dänemark vereinbart. Es erfolgte keine Konsultation mit der Nationalversammlung. Ein bedeutender Anteil der Abgeordneten verspürte eine Entmachtung. Insbesondere die linksliberalen und radikaldemokratischen Kräfte interpretierten dies als Verrat an der Revolution und der nationalen Sache. Der Unmut entlud sich im sogenannten Septemberaufstand, bei dem die Aufständischen versuchten, die Nationalversammlung zu stürmen. Der Aufstand wurde mit einem hohen Blutzoll niedergeschlagen. Dies kann als frühes Signal für das Scheitern der revolutionären Bewegung interpretiert werden.
Zwischen Burschenschaft und Politik
In dieser aufgeheizten Situation trat Heinrich von Gagern, Präsident der Nationalversammlung und selbst Burschenschafter, als Vermittler auf. Gagern stand für den gemäßigten Liberalismus: Er war national gesinnt, aber auf Ausgleich bedacht und suchte eine Balance zwischen revolutionärem Idealismus und politischer Realpolitik. Sein eigener Hintergrund als Mitglied einer Burschenschaft – jener studentischen Verbindungen, die seit den Befreiungskriegen Träger nationaler und liberaler Ideen waren – verlieh seinen Worten besonderes Gewicht. Denn viele Abgeordnete verbanden mit den Burschenschaften die Vorstellung von Einigkeit, Freiheitsliebe und Opferbereitschaft für die Nation.
Blutige Eskalation in Frankfurt
Als Gagern am 19. September 1848 die Sitzung der Nationalversammlung eröffnete, lag also aus gleich zwei Gründen Schwere in seiner Stimme. Am Vortag hatten Aufständische gleich zwei Mitglieder der Nationalversammlung ermordet, den preußischen Generalmajor von Auerswald und Fürst Felix Maria von Lichnowsky, deren Tod Gagern bedauerte: „Es war diesen ritterlichen Männern nicht beschieden […] den Tod zu finden für das Vaterland in Verteidigung seiner Ehre gegen äußere Feinde. […] Ich will nicht aufregen, aber das Gefühl der Scham für die Schmach, welche durch solche Tat über die Nation kommt, kann ich nicht unterdrücken.“
In seinen Ausführungen bezeichnete er die Unruhen in Frankfurt als „Verbrechen gegen die Freiheit“ und ein die „Menschlichkeit entwürdigendes Verbrechen“ und betonte: „Es ist leicht, mittelst dieser Versammlung, bei einer Velleität von Abneigung gegen einzelne Persönlichkeiten, bei der Unzufriedenheit und Kritik über einzelne Regierungshandlungen, ein Ministerium zu stürzen, aber schwer, dass eines sich wiedergestalte, und daraus muss für diese Versammlung die Warnung hervorgehen, dass es unerlässlich sei, […] unsern ganzen Zustand in Erwägung zu ziehen und genau zu untersuchen […].“
Mahnung zur Mäßigung
Vor diesem historischen Hintergrund lassen sich Gagerns Reden in der Paulskirche besser verstehen. Sie spiegeln den Versuch wider, den Traum von Einheit und Freiheit zu bewahren, ohne dabei die politische Ordnung ins Chaos stürzen zu lassen. Gagerns Schlussworte wirken in diesem Kontext wie ein Kassandraspruch: „Wollen wir die Freiheit, so müssen wir sie mit Maß wollen und ihr Maß lehren; wollen wir die Einheit, so lassen Sie uns vor Allem hier einträchtiger zusammenwirken!“
Doch diese Aufforderung verhallte, zu wenige hörten sie, und den demokratischen Kräften mangelte es an der notwendigen Einheit und Führung, um gemeinsame Ziele zu verwirklichen. Der Sturm der Revolution wendete sich. Theodor Fontane beschwor dieses Gefühl in einem Antwortschreiben an seinen Freund Bernhard von Lepel: „Ich bin nicht in der Stimmung, auf deinen unendlich friedlichen Brief, der nach Abgeschiedenheit und nach jedem beliebigen Jahrgang – nur nicht nach 1848 schmeckt einzugehn – die Ereignisse der letzten Tage […] erklären geradezu die Konterrevolution und fordern zum Kampf heraus. […] Mit dürren Worten: Hast du nicht auf väterlicher Rumpelkammer eine alte, aber gute Büchse?“
Die vertane Chance der Revolution
Das Geschehen um den Waffenstillstand von Malmö, den Septemberaufstand und Gagerns mahnende Worte in der Paulskirche verdeutlichen, in welchem Ausmaß sich 1848 Hoffnungen und Ernüchterung, Idealismus und politische Realität gegenseitig bedingten. Heinrich von Gagern verkörperte den Versuch, den revolutionären Elan in geordnete Bahnen zu lenken und die Einheit des Vaterlandes nicht durch unkontrollierte Gewalt, sondern durch besonnenes politisches Handeln zu erreichen. Seine Appelle an Maß und Einigkeit verhallten ungehört in einer fragmentierten politischen Landschaft: Monarchische Mächte, uneinige Revolutionäre und die sich manifestierende Müdigkeit in der Bevölkerung raubten der Bewegung ihre Dynamik.
Die Tatsache, dass Gagern als Burschenschafter aus einer Tradition stammte, die einst für Freiheit, nationale Einheit und Opferbereitschaft stand, verleiht seinen Worten einen nahezu tragischen Unterton. Die Revolutionäre von 1848 strebten die Schaffung eines geeinten, freien Deutschlands an, scheiterten jedoch an internen Spaltungen und mangelnder politischer Macht. Gagerns Aufruf zur Mäßigung kann in diesem Zusammenhang als ein Symbol für die verpasste Chance der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung betrachtet werden, deren Ideale erst Jahrzehnte später, in veränderter Form, Wirklichkeit wurden.
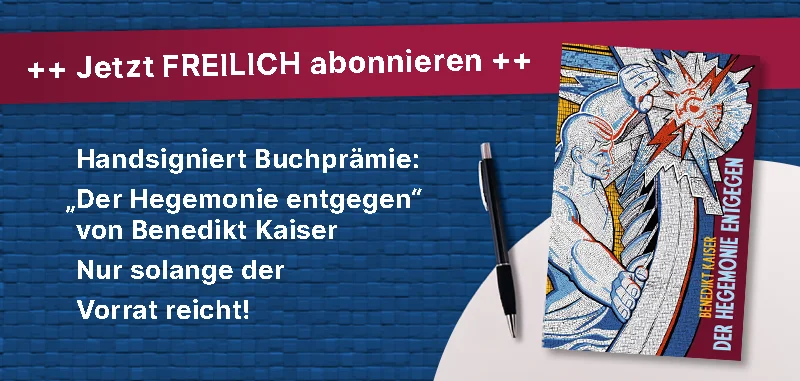
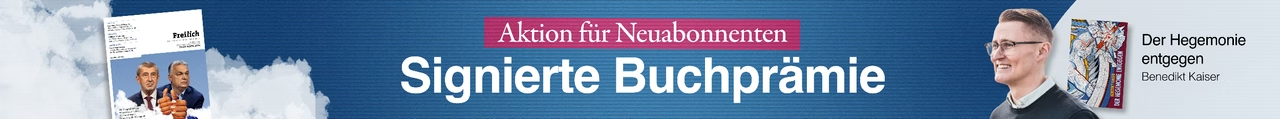

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!