Der mexikanische Filmemacher Guillermo del Toro steht für eine Art Kino, die sich mit Nischenthemen wie missverstandenen Außenseitern auseinandersetzt und klassische Stoffe wie die Pinocchio-Geschichte neu interpretiert. Typisch für seine Filme sind cineastisch beeindruckende Bilder und Sets, die mit bunten, noch nie gesehenen Kostümen gefüllt sind. Alles ist mit einer Detailtiefe gestaltet, die in heutigen Blockbustern nur noch selten zu finden ist. 2018 präsentierte del Toro mit The Shape of Water eine solche Geschichte: ein Hochsicherheitslabor, ein mysteriöses Fischwesen und eine schüchterne Frau. Für diesen Film gewann del Toro zwei Oscars.
Mit Mary Shelleys Frankenstein hat sich del Toro einen Stoff ausgesucht, der bereits unzählige Male für Kino und Fernsehen adaptiert wurde – meist mit Fokus auf das „Monster“. Dabei blieben die anderen Aspekte, wie das Abgleiten in den Wahnsinn, die dunklen Seiten des Menschen, das Groteske und Unheimliche, oft unbeachtet. Doch gerade diese Elemente, die der italienische Denker Mario Praz als „Schwarze Romantik“ bezeichnete, machen den Reiz von Shelleys Briefroman aus. Del Toros Film legt genau auf diese Punkte den Schwerpunkt.
Ein Klassiker der Schwarzen Romantik
Nun also zum Film: Er wurde auf Netflix veröffentlicht und läuft in einigen ausgewählten Kinos. Allein wegen der Bilder, Szenen und Kostüme lohnt sich jedoch ein Kinobesuch. Zur Handlung muss nicht viel gesagt werden: Der junge Chirurg Viktor Frankenstein möchte den Tod überwinden und neues Leben erschaffen. Dafür geht er bis an die Grenzen seiner Kräfte – nur um am Ende ein Wesen zu erschaffen, das nicht seinen Vorstellungen entspricht. Del Toro hält sich dabei nicht sklavisch an die Romanvorlage, was dem Film gut tut. Denn: Um sowohl Viktors Abstieg in den Wahnsinn als auch die Perspektive seines Geschöpfs zu zeigen, benötigt Del Toro kreative Freiheit.
Mit Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac und den Österreichern Christoph Waltz und Felix Kammerer hat del Toro ein Ensemble versammelt, das kaum besser gewählt sein könnte. Besonders Oscar Isaac als Viktor Frankenstein geht völlig in seiner Rolle auf und zwingt das Publikum, sich mit einem ambivalenten Charakter auseinanderzusetzen: einem ehrgeizigen jungen Chirurgen, der gegen eine konservative Gesellschaft und verkrustete Denkweisen ankämpft – und doch selbst zum Schöpfer des wahren Grauens wird. Man versteht Viktor – und ekelt sich zugleich vor ihm. Genau in dieser Spannung liegt die Stärke seiner Darstellung.
Ein Ensemble, das funktioniert
Das Monster, gespielt von Elordi, tritt erst nach etwa einer Stunde auf und zeigt sich als Geschöpf, das einerseits von außen zum Monster gemacht wird, andererseits durch seine Entstehung selbst eine monströse Natur in sich trägt – vom Äußeren ganz zu schweigen. Del Toro und Elordi gelingt es, das Frankenstein-Monster auf bislang ungesehene Weise menschlich zu zeigen, ohne in Küchenpsychologie oder banale Erklärungsmuster zu verfallen, wie es viele moderne Filme tun. Die für Fantasy- und Schauerstoffe der Schwarzen Romantik typische, rohe, überschüssige Energie bleibt erhalten.
Del Toro vermeidet es, das Magische und Übernatürliche zu entzaubern oder alles rational zu erklären. Frankensteins Versuch, den Tod zu besiegen, wird nicht naturwissenschaftlich hergeleitet und sein Wahn nicht auf ein Trauma reduziert. Auch Goths Figur Elisabeth handelt einfach, ohne dass es dafür Erklärungen gibt. Versteht man sie? Nein, aber gerade dieses Rätselhafte macht den Reiz solcher Stoffe aus. Frankensteins Monster umgibt eine Aura, die sich weder mit Formeln noch mit Thesen erklären lässt – etwas, das in der modernen Welt immer seltener geworden ist.
Keine Erklärungen, keine Entzauberung
All das wird von einer gewaltigen Bildsprache begleitet, die an die Filme von Ridley Scott erinnert: imposante Totalen und überwältigende Szenen. Die Perfektion wirkt manchmal fast zu glatt, doch gerade das passt: diese Geschichten sollen nicht „aufgehen“. Das macht den Film umso magischer, ohne künstlich zu wirken. Wer Filme liebt, die durch Kostüme, Atmosphäre und visuelle Wucht überzeugen, kommt hier voll auf seine Kosten. Große inhaltliche Überraschungen darf man bei einer bekannten Geschichte allerdings nicht erwarten, denn wer del Toro wegen eines genialen Drehbuchs schaut, ist ohnehin falsch beraten.
Übrigens: Obwohl ein Netflix-Film, ist Frankenstein hier kein ideologisches Projekt. Keine „woke“ Neubesetzung, keine feministische Kampfansage, keine politische Überfrachtung – del Toro bleibt ganz bei der klassischen Erzählung.
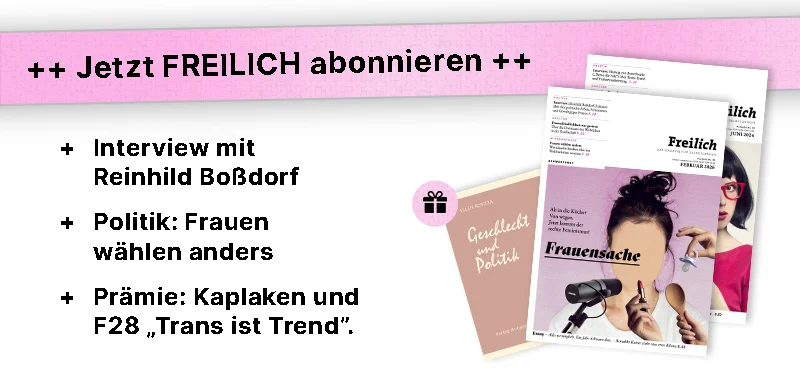


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!