Am Dienstag fällte die Stadt Hannover den folgenschweren Entschluss, seinen Schriftverkehr vollkommen auf genderneutrale Formulierungen umzustellen. Ohne Not leistet die niedersächsische Hauptstadt damit einer in der Forschung wie Bevölkerung ebenso umstrittenen Ideologie heftig Vorschub.
Kommentar von Julian Schernthaner
Wenn Ihnen die Überschrift gefällt, werter Leser, dürfen Sie die Lorbeeren für diesen Einfallsreichtum leider nicht vollständig auf mein Haupt setzen. Sie bezieht sich nämlich auf ein einflussreiches Werk des US-amerikanischen Sprachwissenschaftlers George Lakoff. Dieser nahm in Women, Fire and Dangerous Things eine Nominalklasse der aussterbenden australischen Sprache Dyirbal als Ausgangspunkt für seine Hypothese, wonach Kategorien unser kognitives Denken beeinflussen. Was das mit Hannover zu tun hat? Ziemlich viel.
Sprache als Schlachtfeld der Gleichberechtigung
Denn mit diesem Buch reihte sich Lakoff nahtlos in eine dominante Schule in der zeitgenössischen Sprachwissenschaft ein, welche der sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese folgt. Diese besagt im Kern, dass die semantische – also die Bedeutung von Zeichen betreffende – Struktur und der Wortschatz unserer Muttersprache unser Denken beeinflusst. Auch die feministische Linguistik, deren Begründung pikanterweise auf dessen Ex-Frau Robin Lakoff zurückgeht, klammert an diesem Strohhalm.
Das genannte Forschungsgebiet ist deshalb auch der Ansicht, dass eine Veränderung der Sprache notwendig ist, um die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft voranzutreiben. Eine wirkliche Gleichstellung könne nur anhand eines durch die Sprache ausgelösten Bewusstseinswandels überhaupt möglich werden. Aus diesem Grund, so die Annahme, wäre es unumgänglich, Frauen in der Sprache stärker sichtbar zu machen – andernfalls wäre das hypothetische Patriarchat quasi ewig. Dem sogenannten generischen Maskulinum gilt deshalb der Kampf.
Inkonsequenz der konsequenten Verballhornung
Der grammatikalische Reichtum der deutschen Sprache ermöglicht hier sonderbarste Stilblüten. Lateinische Partizipialkonstruktionen bekommen ein deutsches Partizip hinzu. An der Leipziger Uni ist die weibliche Form nötig. In Hannover dürfen keine geschlechtsbezogenen Anreden mehr in den Schriftverkehr. Einzig die Konsequenz fehlt hierbei: Denn, wie die Erfahrung des „Binnen-I“ zeigte: negative Sachverhalte und Beschreibungen bleiben zumeist genuin männlich.
Selten beschweren sich linksradikale Akteure über ‚FaschistInnen‘, polizeiliche Presseaussendungen postulieren selten eine ‚Täterin‘. Eine Diskussionsrunde über Gewalt an Frauen im österreichischen Fernsehen kam kürzlich überhaupt ohne diese weibliche Form aus. Ohne das Tabuthema häuslicher Gewalt an Männern thematisieren zu müssen, wäre ja anzunehmen, dass Gewalt an Frauen zumindest auch in lesbischen Beziehungen denkbar wäre. Außer natürlich, man betreibt tatsächlich sexistisches Framing.
Patriarchale Kulturen: Oft kein sprachlicher Unterschied
Apropos: Ich bin übrigens kein Bösmensch, dessen Frauenbild sich ein malochendes Heimchen in völliger Knechtschaft erträumt. Frauen sollten prinzipiell dieselben Chancen im Leben genießen wie Männer, selbstbestimmtes weibliches Wirken verdient neidlose Würdigung. Auch gäbe es keine gerechte Sache, welche ohne die Teilnahme engagierter Aktivistinnen noch nachhaltigen Mehrwert hätte. Nur: Weder das Binnen-I, noch der Genderstern, noch irgendwelche Partizipialkonstrukte haben die soziale Stellung einer einzigen Frau jemals verbessert.
Würde Sprache gottgegeben die Mentalität beeinflussen, müssten iranische Frauen heute kaum gegen den Kopftuchzwang protestieren. Denn die persische Sprache legte jegliches grammatisches Geschlecht bereits vor 2.000 Jahren ab. Auch das Armenische seit Jahrhunderten und das Türkische seit Anbeginn kennen diese Unterscheidung nicht. Dennoch sind beide zugehörigen Kulturen auf ihre eigene Weise patriarchaler als jedes noch so konservative mitteleuropäische Land. Einschließlich Ungarns, dessen Sprache diesen Unterschied übrigens ebenso wenig kennt.
Dogma mit mittelalterlichem Eifer
Wenig verwunderlich trifft das Thema abseits akademischer und politischer Kreise auf breite Ablehnung. Die Menschen stemmen sich verständlicherweise gegen einen erzwungenen Sprachwandel. Dass das liberale, feministische Schweden sich heute unter dem läkaren (‚Arzt‘) ebenso gut eine Frau vorstellen kann, ist übrigens keine Folgeerscheinung der im Frühneuschwedischen aufgehobenen grammatikalischen Unterscheidung, sondern eines unabhängigen gesellschaftlichen Wandels. Zumal die Schweden etymologisch ohnehin meist die männliche Form weiterführten.
Und doch ist die Hypothese einer ‚gendergerechten Sprache‘ heute so etwas früher das geozentrische Weltbild. Ein Mann der sich dagegen stellt, gilt als Chauvinist. Eine Frau, welche es ablehnt, wird schnell als Erfüllungsgehilfin des nebulösen Unterdrückers diffamiert. Die Hinterfragung dieses modernen Dogmas erntet Blicke, als hätte man soeben die Schwerkraft geleugnet. Wer sich im Mittelalter an Hexenverbrennungen ergötzte, würde heute wohl über ‚Gendersünder‘ herfallen wie ein wildes Tier.
Akademischer Wettstreit muss möglich bleiben
Diesen mittelalterlichen Eifer musste ich auch an der Universität feststellen. Der akademische Wettstreit lässt bekanntlich viele Theorien als legitim gelten – und aus diesem Grund besuchte ich während meines linguistischen Studiums eine Vorlesung zu feministischer Linguistik. Schnell war aber klar: In einer Hochschule, der geisteswissenschaftliche Fakultäten einem linken Marsch durch die Institutionen unterworfen waren, ging es nicht um den akademischen Wettstreit. Es ging um die Vermittlung eines Dogmas.
Also mimte ich den Feigling, und verschaffte mir das restliche Semester eine Freistunde. Zu meinem Glück folgte ich noch der alten Studienordnung und entkam somit einer Verpflichtung. Ich entkam somit auch dem Schicksal einiger männlicher Studenten bei einer späteren Gastprofessorin im Fach, welche männliche Referenten aus feministischem Prinzip schlechter benotete. Ähnlich ging es den wenigen Frauen im Kurs, welche diese These kritisch sahen. Bei meiner Diplomarbeit stahl ich mich übrigens durch eine geschickte Formulierung aus der Affäre. Bratpfanne und Staubsauger kenne ich trotzdem nicht ausschließlich vom Anschauen.
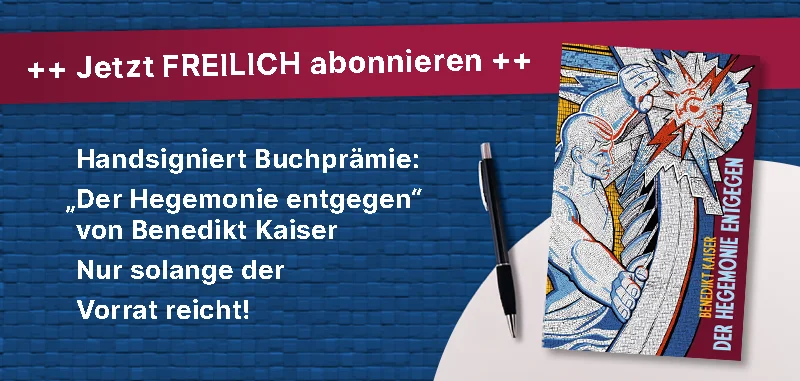


![Symbolbild: Nick Youngson / Alpha Stock Images via Picpedia [CC BY-SA 3.0] (Bild zugeschnitten)](https://img.freilich-magazin.com/-/article/plain/s3%3A%2F%2Ffreilich%2F2019%2F01%2Fgender-1200.jpg@webp)


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!