Die bekannte US-Politikerin Tulsi Gabbard verlässt die Demokratische Partei und brachte sich so wieder ins Gespräch. Grund genug für Ben Austin, das Phänomen Gabbard genauer zu besprechen.
Am 24. Februar 2022 schrieb die kürzlich aus der Demokratischen Partei ausgetretene Tulsi Gabbard, die NATO und die Biden-Regierung hätten den gerade ausgebrochenen Ukraine-Krieg vermeiden können, wenn sie die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt und die Ausweitung der NATO in die Ukraine vermieden hätten. Daraufhin entlud sich der vorhersehbare Sturm der Entrüstung aus den Reihen der staatstragenden Linken in den USA: Die Veteranin Gabbard sei eine Landesverräterin, eine russische Agentin und liege überhaupt falsch mit ihrer Einschätzung, die Ukraine könne russische Sicherheitsinteressen bedrohen. Mit ihrer Aussage gab Tulsi Gabbard die Position des außenpolitischen Realisten John Mearsheimer wieder, allerdings als hawaiianische Frau mit samoanischen Wurzeln, die jugendliche Energie ausstrahlt, surft, Yoga macht und ihr Leben nach dem Bhagavad Gita richtet.
Ihr Bild als Dissidentin innerhalb der Demokratischen Partei erarbeitete sie sich insbesondere im Jahr 2019 durch die Auseinandersetzung mit Hilary Clinton, die behauptete, „die Russen“ würden Gabbards Kandidatur in den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl begrüßen und diese als Kandidatin einer dritten Partei in Stellung bringen. Gabbards Fangemeinde im alternativen Teil des patriotischen Spektrums, das die vorherrschende amerikanische Außenpolitik vom Irak bis hin zu Syrien und Russland kritisch sieht, feierte sie spätestens 2019 an dem Punkt, als sie vermehrt den Hass des linken Establishments auf sich zog: Schon 2014 fand sie erstmals zustimmende Erwähnung beim konservativen Medium Breitbart, das ihre Positionen zur Innen- sowie Außenpolitik ab 2019 regelmäßig mit sympathisierenden Beiträgen würdigte. Auch das anerkannte libertäre und nicht-interventionistische Urgestein Ron Paul äußerte, er würde ihre Außenpolitik teilen, allerdings nicht ihre Wirtschaftspolitik.
Sympathien von Rechts…
Bei der Präsidentschaftswahl enttäuschte sie jedoch die Hoffnungen ihrer Unterstützer und die Befürchtungen des linken Establishments bestätigten sich nicht: Am 19. März 2020 zog Gabbard ihre Kandidatur zurück und empfahl ihren Anhängern die Wahl von Joe Biden, der den Kriegskurs seiner Partei fortsetzte. Im Juli 2020 sagte Gabbard in der linksliberalen Talkshow „The View“, Trump würde zu Rassismus und Gewalt anstacheln. Vor allem aber wegen einer anderen Zugehörigkeit rumort es im Netz bei Konservativen und Rechtslibertären, die Gabbard nicht abnehmen, sie sei eine von ihnen: Sie stand 2019 auf der Mitgliederliste des Council on Foreign Relations (CFR), der sich als einflussreiche Interessenvereinigung für die amerikanische Hegemonie einsetzt und bereits 2016 war sie Gastgeberin einer Veranstaltung des Vereins.
Diese Umstände könnten bei manchem Beobachter Zweifel an der Aufrichtigkeit aufkommen lassen angesichts ihres Engagements für die Opfer der NATO-Politik etwa in Syrien: So nahm sie von einer 2018 getätigten Aussage, die USA würden seit 2011 dort einen Krieg für „Regime Change“ führen, später wieder Abstand und bezeichnete den Präsidenten Assad nun doch als „brutalen Diktator, wie Saddam Hussein“. Eine massenmedienkonforme Haltung zum amerikanischen Feind des Tages gehört zum Pflichtrepertoire der CFR-Mitglieder, sodass Gabbard ihre ursprüngliche Positionierung wohl aufgeben musste.
… aber vielleicht ungerechtfertigt?
Die Aufmerksamkeitsspanne des amerikanischen Publikums ist allerdings kurz, sodass mancher Anhänger geneigt sein wird, Gabbard diese ideologischen Fremdgänge vor dem Hintergrund ihrer Kampfansage an die Demokraten zu verzeihen. In einer kraftvollen Rede erklärte Gabbard ihren Austritt aus der Demokratischen Partei und begründete diesen Schritt damit, dass die Partei unter totaler Kontrolle elitärer Ränkespiele von Kriegstreibern stünde, die von feiger Wokeness angetrieben seien. Mit dieser vernichtenden Analyse, die zudem aus dem Mund einer Veteranin kommt, wirkt Gabbard wie Sahra Wagenknecht auf Hawaii getrimmt: charmant, links, patriotisch und nicht verlegen um klare Worte.
Die Demokraten würden zudem die Bevölkerung spalten, indem sie überall den Rassenkampf ausrufen und antiweißen Rassismus schüren. Hier bearbeitet Gabbard einen politischen Topos, vor dem selbst und gerade Republikaner zurückschrecken: Um die Verteufelung und Diskriminierung der amerikanischen Bevölkerung europäischer Abstammung nicht als „antiweiß“ bezeichnen zu müssen, greifen die Republikaner auf rhetorische Floskeln wie „Spaltung“, „Critical race theory“ oder „Sozialismus“ zurück. Um ihr verfassungspatriotisches, antirassistisches Kredo zu untermauern, umwerben die Republikaner explizit Afroamerikaner, Latinos und andere Minderheiten, nennen aber unter keinen Umständen die weiße Bevölkerung beim Namen, die sie mehrheitlich wählt und (gerade noch) die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht. Besucher von Veranstaltungen der Republikaner, die es wagen, die größte Wählergruppe beim Namen zu nennen, werden wie Aussätzige behandelt und unverzüglich hinausbegleitet. In einem Akt der politischen Klugheit versucht Gabbard diese klaffende Repräsentationslücke zu schließen, während sie gleichzeitig die Klaviatur der „Spaltung“ bespielt.
Eine riskante Gratwanderung
Ihr lockendes Angebot an das patriotische Spektrum erweitert Gabbard, indem sie kritisiert, dass man Polizisten denunziert und gleichzeitig Kriminelle auf Kosten gesetzestreuer Bürger schützt. Auch hier kann sie in ein Vakuum hineinstoßen, das die Republikaner und insbesondere Trump geschaffen haben: Anstatt der Verwüstung amerikanischer Städte mit dem Einsatz von Bundesbehörden ein Ende zu setzen, wie von seinen Anhängern gefördert, hat Trump mit dem „First Step Act“ eine zentrale Forderung der BLM-Randalierer umgesetzt und massenhaft Kriminelle aus der Haft entlassen. In der Folge stieg die Kriminalität weiter.
Während Gabbard den laschen Umgang mit Kriminellen moniert, geht sie gleichzeitig auf den politischen Missbrauch der Sicherheitsbehörden ein und führt in einem separaten Video schockierende Beispiele auf: Sieben Lebensschützern drohen elf Jahre Haft und Geldstrafen von 250.000 Dollar, weil sie im Rahmen einer Demonstration den Zugang zu einer Abtreibungsklinik blockierten. Das Justizministerium unter Biden hat eine neu geschaffene Anti-Terror-Behörde protestierenden Eltern auf den Hals gehetzt, die sich bei Treffen der Elternvertretungen gegen Lehrpläne mit (links)radikalen Inhalten und Frühsexualisierung ausgesprochen haben. Bei der Ansprache erwähnt Gabbard allerdings nicht die Stoßrichtung weit verbreiteter Lehrpläne, die Schülern europäischer Abstammung einen angeborenen Rassismus bescheinigen und sie für Sklaverei, Kolonialismus und Rassentrennung verantwortlich machen.
Trotz dieses Versäumnisses wirkt Gabbard mit ihrer Kritik am Missbrauch durch Sicherheitsbehörden glaubwürdiger als alle Demokraten und die meisten Republikaner: Letztere forderten erst dann, dem FBI die Geldmittel zu streichen, als die willkürliche politische Verfolgung mit Trump einen von ihnen getroffen hat. Nachdem der Medienskandal etwas abgeklungen ist, sind auch die Rufe nach Streichung der Mittel verstummt. Gabbard greift auch den fehlenden Grenzschutz auf, den die Republikaner unter Trump trotz gleichzeitiger Kontrolle des Parlaments und der Präsidentschaft kaum nachhaltig verbessert hatten.
Eine Welle der Empörung
Nach diesem Paukenschlag gegen den Sicherheitsstaat im Inneren wendet sich Gabbard erneut der Außenpolitik zu mit einer Warnung vor der nuklearen Eskalation, die von den Demokraten als den maßgeblichen Akteuren der amerikanischen Außenpolitik ausgeht. Eine neuerliche Aussage des ehemaligen CIA-Direktors Michael Hayden hilft, um die Geisteshaltung des außenpolitischen Establishments zu verstehen: Hayden, der von George W. Bush zum Direktor der CIA ernannt wurde, gab einem Twitter-Nutzer recht, der die heutigen Republikaner als nihilistisch, verachtenswert und gefährlicher als jeden äußeren Feind bezeichnet hatte. Bis auf eine Minderheit unter den republikanischen Abgeordneten fordern beide Parteien die uneingeschränkte finanzielle Unterstützung der Ukraine und eine aggressive Haltung gegenüber den anderen Feinden des außenpolitischen Establishments wie Russland, Iran oder China. Indes lässt die Bereitschaft der Amerikaner nach, einen weiteren, nie enden wollenden Krieg zu finanzieren, zumal die erhöhten Energiekosten zunehmend zu Buche schlagen und die Befürworter des Krieges die Steuerzahler offen verachten. In zwölf Monaten haben die USA mehr Geld für die Ukraine ausgegeben als für den eigenen Bundesstaat West Virginia.
Auch hier spricht Gabbard die unbefriedigte Forderung vieler Amerikaner an, von Kriegen weit von der Heimat abzulassen und stattdessen die eigene Grenze zu sichern. Bei ihrem Austritt aus der Demokratischen Partei überspringt sie glatt die Konsenspositionen mit den Republikanern und spricht diejenigen an, die sich in keiner der großen Parteien wiederfinden. Am Ende ihrer bewegenden Ansprache forderte Gabbard andere Demokraten auf, sich anzuschließen und die Partei ebenfalls zu verlassen. Dient dieses Manöver am Ende doch den Interessen ihrer (ehemaligen?) Freunde beim Council on Foreign Relations? Sind ihre Auftritte nur eine Finte, um nicht-woke Linke und kritische Rechte auf ein sicheres Abstellgleis zu lenken? Ein solches Täuschungsmanöver würde in den USA nicht überraschen, wo doch die Republikaner ihre Gallionsfiguren bei zwielichtigen Schauspielervermittlungen aufgabeln. Allerdings ist der Auftritt eine Wegmarke für die Stimmung in den USA: Vielen Bürgern stehen antiweißer Rassismus, LGBT-Ideologie, teure Kriege, Narrenfreiheit für Kriminelle und die willkürliche Verfolgung von Dissidenten bis hin zu harmlosen Lebensschützern bis zum Hals, und diese sympathische Hawaiianerin surft auf einer mächtigen Welle der Empörung.
Zur Person:
Ben Austin ist in Colorado geboren, hat an der University of Maryland Germanistik studiert und arbeitet in Berlin als politischer Referent.
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100059511017179
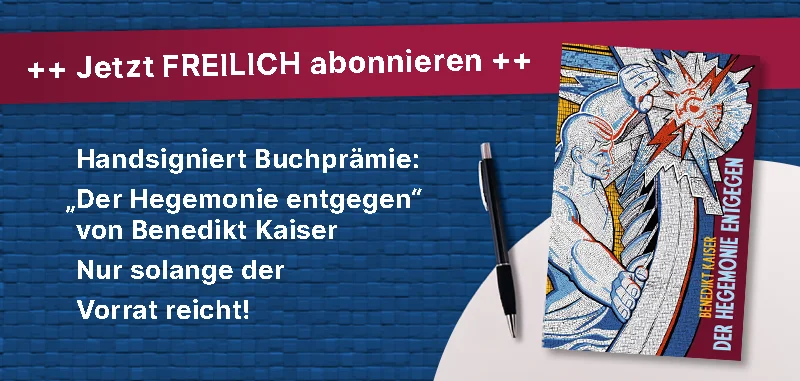
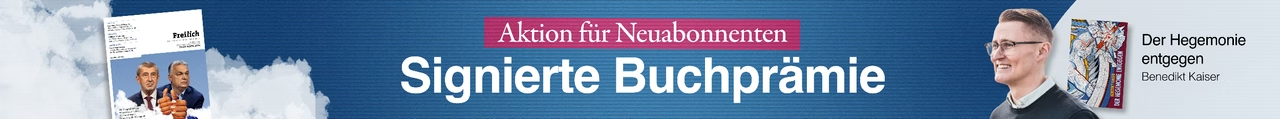

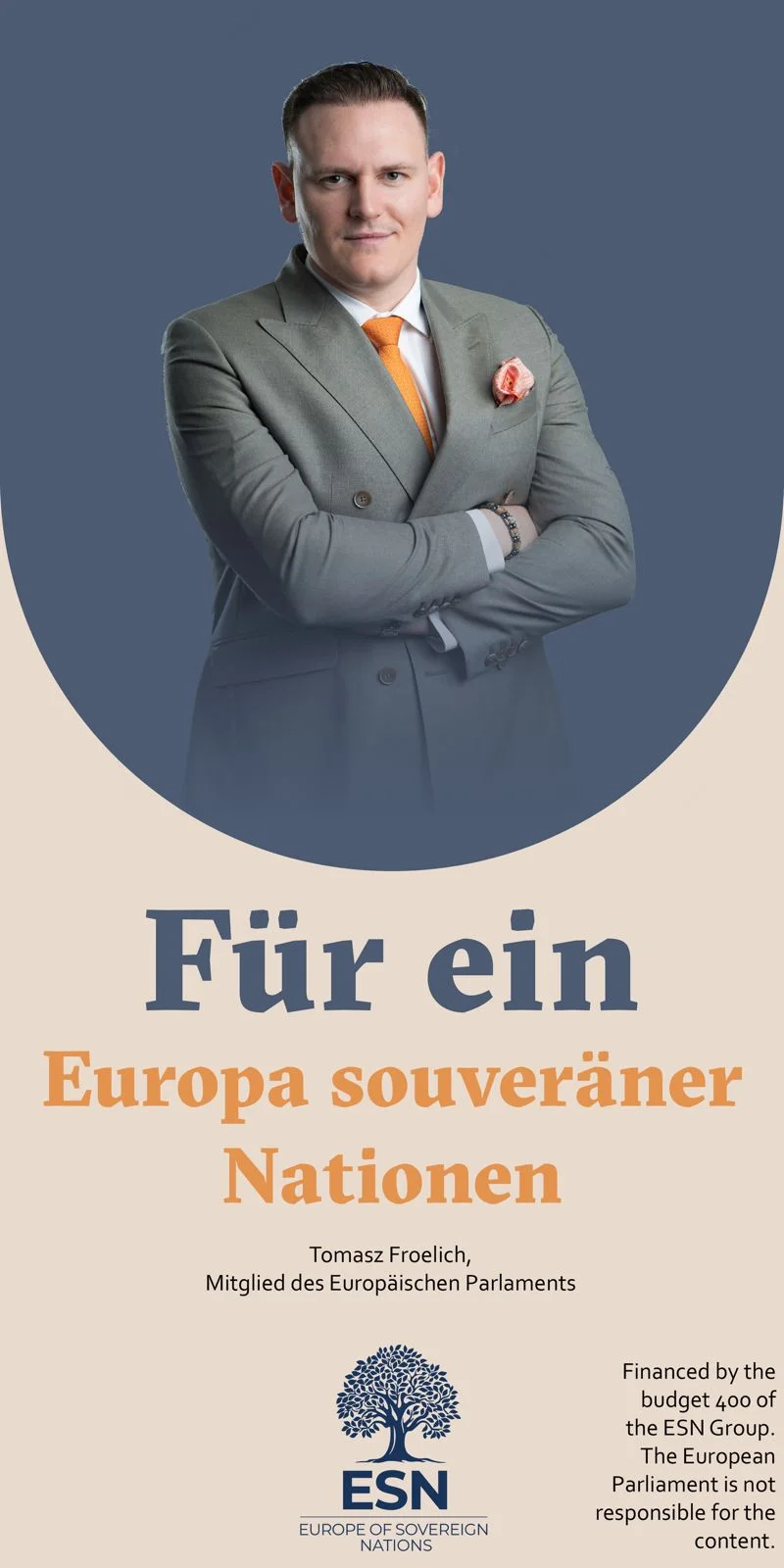

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!