Es gibt grundlegende Verhältnisse des Politischen, die so alt und elementar sind, dass sie von modernen Ordnungen kaum noch wahrgenommen werden. Sie stehen nicht in Gesetzen oder Verfassungen. Sie stehen auch nicht in der Sprache der Bürokratie. Sie existieren in einem Bereich, der über die Jahrhunderte gleich geblieben ist. Dieser Bereich ist der Bereich von Schutz und Treue.
Dieses Verhältnis ist älter als Staaten, älter als Schrift und älter als Homer. Es entspringt der elementaren Erfahrung, dass der Mensch nur dort politisch lebt und leben kann, wo er sich geschützt weiß, und dass jeder Schutz eine Gegenleistung erfordert. Treue war in Europa seit Jahrtausenden die Antwort auf diese Herausforderung. In ihr verdichtet sich die Bereitschaft eines Menschen, für die regionale oder lokale Gemeinschaft, die ihn trägt, einzustehen – später auch für die nationale. In ihrer letzten Konsequenz fordert sie das Kostbarste, das ein Mensch geben kann: sein Leben. Hieraus entsteht Politik. Die Frage, wie dieses Gemeinwesen zu ordnen ist, das ein Mensch letztlich mit dem Tod verteidigt, beschäftigt die Europäer seit jeher – sie ist unvermeidlich.
Die Gegenseitigkeit als Ursprung des Politischen
Eine der Einsichten der politischen Anthropologie Wilhelm Mühlmanns besagt, dass jede Ordnung aus Gegenseitigkeit hervorgeht. Mühlmann identifiziert fünf Konstanten menschlicher Kultur, die als formale Prinzipien jeder stabilen Ordnung zugrunde liegen. Eine dieser zentralen Konstanten ist das „Prinzip der Gegenseitigkeit in allen Bereichen“, also die Tatsache, dass menschliche Gemeinschaften auf einem Austauschverhältnis beruhen. Anders als Libertäre es gerne denken, ist diese Austauschbeziehung nicht freiwillig, sondern aufgrund der existenziellen Gefahr der Natur und Lebenswirklichkeit auch von einem konsensuellen Zwangscharakter geprägt.
Ein Blick in die europäische Geschichte beweist es: In der attischen Polis gab es keine Trennung zwischen Bürger und Soldat. Solon verband Rechte und Pflichten untrennbar miteinander. Wer in der Polis Schutz und Teilhabe genoss, musste auch für sie eintreten. Auch Aristoteles betrachtete die Gemeinschaft als Schutzverband, dessen Zweck nicht im Herrschen, sondern im Ermöglichen eines guten Lebens besteht.
Ähnliches gilt für Rom. Für Cicero war die Römische Republik eine „Gemeinschaft des Rechts und des Nutzens“, die auf der natürlichen Neigung der Menschen zueinander gründet. Der Bürger diente, weil das Gemeinwesen ihn schützte, und das Gemeinwesen schützte ihn, weil der Bürger diente. Im römischen Gemeinwesen war der B��rger jener, der die Ordnung mittrug, weil er in ihr sein geschichtliches Schicksal erkannte.
Die historisch greifbare Form dieser Gegenseitigkeit ist das Lehnswesen des Mittelalters. Es beruhte nicht auf abstrakten Normen, sondern auf persönlicher Bindung. Der Lehnsherr war nicht Herr, weil ein verschriftlichtes Gesetz ihn dazu bestimmte, sondern weil er Schutz bot – militärisch, wirtschaftlich und existenziell. Der Vasall antwortete darauf mit Treue und Gefolgschaft. Versagte der Lehnsherr seinen Schutz, verlor er die Treue des Vasallen. Versagte der Vasall seine Treue, verlor er den Schutz. Herrschaft war konditioniert, nicht absolut. Diese Bindung war politisch gerade deshalb stabil, weil sie nicht juristisch, sondern existenziell und religiös untermauert war.
Der jüdische Spenglerianer Will Durant beschrieb das hochkomplexe System von Treue und Schutz folgendermaßen: „In der Theorie war das Lehnswesen ein großartiges System moralischer Gegenseitigkeit, das die Menschen einer gefährdeten Gesellschaft in einem komplizierten Gewebe gegenseitiger Verpflichtung, Schutzgewährung und Treue aneinander band.“ Selbst ein König war nicht ungebunden, sondern in einem Machtsystem eingerahmt: „(…) gewöhnlich waren Europas Könige zur Zeit des Feudalismus jedoch weniger die Herrscher ihrer Völker als die Bevollmächtigten ihrer Vasallen.“
In den gezeigten Ordnungen wird deutlich, dass politische Gemeinschaften in Europa nicht auf Gehorsam, sondern auf, oftmals persönlicher und lokal oder regional gebundener, Gegenseitigkeit beruhen. Wo diese Gegenseitigkeit erodierte, entstand keine organische Ordnung mehr, sondern Dominanz.
Der Staat als Form eines geschichtlichen Volkes
Auch in der Neuzeit wurde dieses Verhältnis rationalisiert, aber auch abstrakter, ohne dass es aufgelöst wurde. Hobbes beschrieb den modernen Staat als Schutzverband: Der Mensch unterwirft sich dem Staat, um Sicherheit zu erlangen. Solange der Schutz gewährleistet ist, ist diese Unterwerfung gerechtfertigt. Locke konkretisierte, dass der Staat existiert, um Eigentum, Leben und Freiheit zu verteidigen. Tut er dies nicht, erlischt seine Legitimität.
Eine staatliche Ordnung wurde auch über Widerstand definiert. In der reformatorischen Tradition – von Calvin bis zu den Monarchomachen – wurde Widerstand anerkannt, wenn der Herrscher seine Schutzpflicht verletzte, da die Legitimität ihrer Ansicht nach zweckgebunden war. Thomas Müntzer argumentierte in theologischer Sprache dasselbe: Die kirchliche und weltliche Obrigkeit verliert ihre Legitimität, wenn sie den Schutz der gerechten und frommen Christen vernachlässigt. Der Bruch des Schutzes führt zum Bruch der Treue.
Hermann Heller betonte im 20. Jahrhundert, dass der Staat in erster Linie ein Schutzverband ist. Er garantiert durch Ordnung den inneren Frieden und äußere Sicherheit. Verweigert er diesen Schutz oder wendet er ihn gegen das eigene Volk an, verliert er seine Daseinsberechtigung. Heller definierte Politik explizit als die „Ordnung des Zusammenwirkens menschlicher Gegenseitigkeitsbeziehungen aller Art“. In all dem erscheint dieselbe uralte Prämisse: Schutz ist die Ursache, Treue die Wirkung.
Die preußischen Reformer knüpften bewusst an die Idee der Gegenseitigkeit an, die vor allem während des Absolutismus gelitten hatte. Während der napoleonischen Besatzung Deutschlands war die preußische Obrigkeit am Ende ihrer Kräfte und Möglichkeiten angelangt. Ähnlich wie in Frankreich setzte man daher auf die Aktivierung der Untertanen – einen ähnlichen Ansatz hatte schon Friedrich der Große verfolgt. Scharnhorst war sich bewusst, dass die Wehrpflicht die preußischen Untertanen nicht erniedrigte, sondern erhob. Denn erst dann kann ein moderner Staat, der eben nicht nur regional oder dynastisch verankert ist, sondern auch nationale Dimensionen bedient, moralisch bestehen, wenn er nicht nur Untertanen, sondern Mitträger hat. Die preußischen Reformen koppelten die Wehrpflicht daher an die Befreiung sowie die Teilhabe der ehemaligen Untertanen und jetzigen Bürger am Staat. Spengler sollte diesen Grundsatz später als preußischen Sozialismus verallgemeinern.
All diese historischen Formen beruhen auf demselben Grundsatz: Das politische Gemeinwesen ist kein Selbstzweck, sondern Ausdruck von Ethnos und/oder Demos. Es ist Form, nicht Ursprung; Gefäß, nicht Inhalt. Seine Legitimität speist sich aus der Aufgabe, die geschichtliche Substanz der Gruppe oder des Volkes zu schützen und zu gestalten. Ein politisches Gemeinwesen, das diese Aufgabe verliert oder pervertiert, fällt aus seinem Wesen heraus. Es wird zu einem rein mechanischen Verwaltungsapparat, der nicht mehr über den Bürger hinausweist, sondern ihn lediglich verbraucht. Denn legitime Herrschaft setzt voraus, dass sich das Volk im Staat wiedererkennt.
Pathos der nationalstaatlichen Bindung
Die moderne Wehrpflicht berührt genau den Bereich, in dem Schutz und Treue ihre tiefste Resonanz entfalten: den Bereich des nationalen Gefühls und die damit einhergehende Opferbereitschaft. Denn neben der funktionalen Gegenseitigkeit und der persönlichen Eigentümlichkeit vormoderner politischer Gemeinschaften, die das nationale Gefühl teilweise auch überlagerten oder verschütteten, kommt in der modernen Ordnung noch die nur wenig rationalisierbare Anziehung zum Gleichen und Ähnlichen hinzu. Es ist diese Art von Beziehung zwischen der sterblichen Einzelgestalt und der überindividuellen Form, die ein Volk durch die Jahrhunderte trägt. An dieser Beziehung verzweifeln Linke seit jeher. Selbst 100 Jahre Kommunismus in Osteuropa konnten das Nationale nicht auslöschen. Damit ist das Gefühl gemeint, das nach dem Ersten Weltkrieg viele junge Männer in den Osten oder nach Kärnten trieb, um neben dem Abenteurertum das Vaterland zu verteidigen. Es ist das Nationale, das sich hauptsächlich in einer bestimmten Dimension zeigt.
Ernst Jünger hat dieses Gefühl mit seiner besonderen Dimension in einer Passage der dritten Fassung von „In Stahlgewittern” beschrieben, die er später wieder entfernte. Nach einer Verletzung kehrt der Protagonist in die Heimat zurück und schreibt:
„Wieder einmal schwirrte deutsche Landschaft, dieses Mal in den Frühschimmer des Herbstes getaucht, an mir vorüber, und wieder ergriff mich wie damals in Heidelberg das wehmütige und stolze Gefühl, dem Lande inner verbunden zu sein durch das im Kampfe für seine Größe vergossene Blut.“
Diese Sätze verdeutlichen eine weitere existenzielle Dimension politischer Bindungen in der Moderne und der Massengesellschaft. Dabei werden kleinere, überschaubare Einheiten wie die eigene Polis oder Region durch den unübersichtlichen Nationalstaat systematisch und ohne Mittler ersetzt. Politische Bindung entsteht dann aus der Erfahrung des Opferns – nicht durch das Opfer selbst, sondern durch die Bereitschaft dazu. Abstrakte, aber dennoch belastbare und organische Bindungen ersetzen somit die persönlichen und nahbaren feudalen Strukturen oder die kleinen, überschaubaren politischen Gemeinschaften der Antike. Das spätere multiethnische Römische Reich stellte in dieser Hinsicht bereits einen Vorläufer dar, da der Wehrdienst für römische Bürger elementar war und der Erwerb der Bürgerrechte davon abhing. Die Legionäre verteidigten nicht nur die Stadt Rom, sondern das Reich.
Im besten Fall war der moderne Wehrpflichtige aufgrund der nationalen Pflicht dazu angehalten, nicht nur das eigene Dorf, sondern auch eine hunderte Kilometer entfernte Landschaft zu verteidigen, sofern dies Deutschland betraf. Diese musste ihm zwar nicht grundsätzlich fremd sein, sie stellte jedoch keinen Teil seiner Lebenswirklichkeit dar. Er wusste jedoch, dass die anderen Wehrpflichtigen auch seine Heimat verteidigen würden. Neben der funktionalen Ebene von Schutz und Treue kommen also noch Liebe und Loyalität zur Nation und zur politischen Gemeinschaft, die sie verkörpert, hinzu. Im Ernstfall zeigte sich diese darin, dass sich zwei fremde Deutsche aus verschiedenen Teilen Deutschlands mit unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten in Kameradschaft dem Feind stellten – mit der Bereitschaft, für den anderen zu sterben, weil er eben ein Deutscher, politisch gefasst in einem Nationalstaat, war, und nicht, weil sie zufällig die gleichen Lehensherren oder Feldherren hatten.
Die moderne Wehrpflicht gießt diese Opferbereitschaft in eine Form und macht sie zu einem Werkzeug, das staatliche und nationale Handlungsfähigkeit ermöglicht. Denn ein Volk und sein politisches Gemeinwesen können sich nur schwer verteidigen, wenn sie nicht organisiert sind – und die Wehrpflicht ist eine Möglichkeit zur Verteidigung.
Hier zeigt sich: Die Form des Staates ist nur dann legitim, wenn sie aus der Substanz des Volkes hervorgeht. Wird sie gegen diese Substanz gewendet, verliert sie ihre Würde. Es kommt zum Bruch.
Der Moment des Bruchs
Eine politische Gemeinschaft bricht auseinander, wenn Schutz und Treue nicht mehr Hand in Hand gehen und das Nationalgefühl verschüttet oder sogar bekämpft oder vernachlässigt wird oder die Führung verbrecherisch wird. Rom ist das klassische Beispiel hierfür. Im 5. Jahrhundert waren die Bürger so verarmt und entfremdet, dass sie das Gemeinwesen nicht mehr als ihr eigenes erkannten. Es brach auseinander und seine Teile konnten oftmals nur noch durch Gewaltmomente, die auf purer Dominanz und nicht auf Gegenseitigkeit beruhten, kurzzeitig existieren. Die Barbaren vor den Toren waren nicht der eigentliche Feind, sondern das zerfallende Reich selbst. Bürger, die nicht mehr geschützt wurden, teilweise sich auch nicht mehr verteidigen wollten oder konnten, wandten sich ab – ins Private, in lokale Bindungen, in neue Loyalitäten, ins Religiöse.
Aus dieser Perspektive muss auch Erik Lehnerts Aussage in der Besprechung eines Buches über Pazifismus und Wehrpflicht betrachtet werden. Sie kann auch als Bejahung einer Wehrpflicht im heutigen Deutschland verstanden werden: „Wehrhaftigkeit setzt aber gerade voraus, dass es um das Ganze geht und dabei keine Unterschiede gemacht werden (…).“ Abgesehen davon, dass die Wehrpflicht in Deutschland mittlerweile nicht automatisch Wehrhaftigkeit garantiert und diejenigen, die alles kaputtmachen, meist nicht diejenigen sind, die alles wieder aufbauen, gilt: Das Problem bei dieser Betrachtung ist, dass die Formel ein „Ganzes“ voraussetzt, ohne nach dessen Qualität zu fragen. Was aber, wenn das Ganze, angelehnt an Adorno, ein falsches ist?
Dies ist die aufgeworfene Frage, wenn man Lehnerts Ausführungen weiterverfolgt. Er schreibt: „Die Vorstellung, daß es eine Wehrpflicht nur dann geben sollte, wenn einem die Regierung oder die Verbündeten passen, verkennt, daß der Parteienstreit nicht darüber entscheiden kann, wem man Dienst schuldig ist, weil diese Einstellung das Ende von Staat und Nation bedeutet.“
An dieser Stelle verdient eine Zuspitzung Raum, die man aus falsch verstandener Rücksicht allzu oft vermeidet und die Marvin T. Neumann auf X auf den Punkt brachte: Es gibt keinen „rechten Pazifismus“. Es gibt nur „vulgärpazifistische und damit unpolitische Menschen“ – und solche, die aus weltanschaulichen und strategischen Gründen eine Haltung gegenüber der „späten Bundesrepublik“ und ihren Institutionen einnehmen. Letztere erkennen das „falsche Ganze“ und lehnen die Wehrpflicht zum jetzigen Zeitpunkt ab. Dementsprechend ist das von Lehnert beschriebene „Ende von Staat und Nation“ längst eingetreten.
Der Parteienstreit ist nur der oberflächlichste Ausdruck dessen. Selbst mit einer AfD-Regierung wäre die Wehrpflicht falsch, wenn die aufgezeigten grundlegenden Prinzipien von Schutz und Treue sowie ein verantwortungsbewusster Umgang mit Nationalgefühl und Opferbereitschaft nicht gegeben wären. Solange das nicht geklärt ist, kann man beim Anblick der Regierung, die so verantwortungslos mit Steuergeldern umgeht, neben notfalllibertären Überlegungen auch notfallpazifistisch sein, wenn man die neusten antinationalen Schritte der Bundesrepublik und ihrer Eliten verfolgt.
Denn: Ein System, das die Grundlagen seiner Gemeinschaft zerstört, kann keine Opferbereitschaft verlangen – und daher nicht das Nationalgefühl ansprechen und daran andocken. Auf dieser Bereitschaft basiert letztlich auch die Wehrpflicht, die wiederum auch eine Voraussetzung für Wehrfähigkeit sein kann. Ein volks- und nationstreues Opferziel kann niemals darin bestehen, sich im letzten Moment für ein Gemeinwesen zu verausgaben, das die eigene Existenz negiert. Man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, die Wehrpflicht für rechte Zwecke im „falschen Ganzen“ nutzen zu können. Ewald von Kleist-Schmenzin brachte es auf die unüberbietbare Formel: „Es ist kein konservatives Kampfziel, sich an den Schwanz eines durchgehenden Pferdes zu hängen, um es bremsen zu können.“
An diesem Punkt gilt also folgende Überlegung: Es gibt letztlich keine Opfer für das „falsche Ganze“.
Die geistigen Gründe der Ablehnung
Das gilt auch für eine rechte Partei: Eine politische Partei kann die Wehrpflicht zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen, sie aber grundsätzlich fordern. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Frage der klugen politischen Kommunikation, die der AfD oft fehlt. Für eine politische Rechte, die weiß, dass die Wehrpflicht keine Einbahnstraße ist, ist es eine Frage der politischen Grundsätzlichkeit.
Die heutige Ablehnung der Wehrpflicht von rechter Seite speist sich weder aus pazifistischen Neigungen noch aus einem individualistisch-anarchistischen Gestus, der Beliebigkeit als Politik missversteht. Sie beruht auf einer Einsicht, die älter ist als jede moderne Überzeugung, nämlich der Dialektik von Schutz und Treue. Wer Treue einfordert, muss Schutz gewähren. Wer Opfer verlangt, muss ein Ganzes bieten, das diese Opfer verdient. In dieser Dialektik liegt der Kern des preußischen Wehrpflichtmodells, das nicht Zwang, sondern Erhebung war – die Integration des preußischen Untertanen in eine staatliche Form, getragen von der Idee, dass Staat, Nation und Volk einander bedingen.
Die Ablehnung der inhaltsleeren Wehrpflicht macht noch keinen anti-nationalen Deutschlandhasser aus einem. Wer den Einsatz des eigenen Lebens an bestimmte Voraussetzungen knüpft, verweigert sich nicht dem Vaterland, sondern misstraut denjenigen, die behaupten, in dessen Namen zu sprechen. Er sieht sich nicht als Untertan, sondern als Bürger. Entscheidend ist immer, wer die Wehrpflicht fordert und welchem politischen Ganzen diese Forderung dient.
Es ist ein Unterschied von entscheidender Größe, ob die preußische Obrigkeit zu den Waffen ruft, um in den Befreiungskriegen das Überleben eines freien Deutschlands zu sichern; ob die entnationalisierte DDR der 1980er-Jahre ihre Wehrpflichtigen zur Stabilisierung eines maroden Systems heranzieht; oder ob eine kosmopolitische Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts die Wehrpflicht erneuern möchte – ein Staat, der das Grundgesetz der Deutschen faktisch zu einem globalen Jedermann-Grundgesetz erklärt hat und damit das fundamentale Verhältnis von Staat, Volk und politischem Dasein suspendiert.
Hat die Wehrpflicht im 21. Jahrhundert überhaupt noch einen Ort?
Daran schließt sich die eigentliche Frage an, die kaum jemand zu stellen wagt: Hat die Wehrpflicht im globalisierten 21. Jahrhundert überhaupt noch einen legitimen Platz?
Betrachtet man die Sache nüchtern, so stellt man fest, dass die Wehrpflicht aus einer Zeit stammt, in der der Staat eindeutig, exklusiv und selbstverständlich der Staat eines bestimmten Volkes war. Es gab ein politisches Innen und Außen, ein Eigenes und ein Fremdes, klare Grenzen, klare Loyalitäten und eine klare Schutzpflicht – und daraus resultierend eine klare Treuepflicht.
Doch wie soll die Wehrpflicht in einer Ordnung funktionieren, in der sich der Staat selbst entgrenzt, in der Bevölkerung nicht als Schicksalsgemeinschaft, sondern als „Menge“ gedacht wird, in der das Verfassungsrecht universalisiert wurde, in der sich der Staat nicht mehr primär als Schutzmacht des Eigenen versteht und in der Loyalität nicht mehr identitär, sondern administrativ verwaltet wird?
Überspitzt formuliert: Die Wehrpflicht ist eine Institution aus dem Zeitalter der Nationalstaaten. Doch wir leben im Zeitalter der (versuchten) Entnationalisierung. Dieser Prozess findet vorwiegend innerhalb der Eliten statt. Aber auch immer mehr im Bürgertum, das nicht mehr Bürger, sondern Untertan sein will. Was früher ein organischer Zusammenhang war – Volk, Staat, Armee – ist heute ein mechanisches Gefüge, in dem die Begriffe zwar noch existieren, aber nicht mehr dieselben Inhalte tragen. Juristisch kann zwar jeder moderne Staat die Wehrpflicht verordnen, doch politisch kann sie kaum ein entgrenzter Staat legitimieren.
Damit stellt sich eine weitere, oft übersehene Frage von erheblicher Tragweite: Steht die Wehrpflicht am Anfang einer neuen reformierten Ordnung – oder kann sie erst am Ende einer solchen politischen Erneuerung eingeführt werden? Die Antwort liegt, wie so oft, in der Geschichte selbst. Die preußischen Reformen schufen nicht die allgemeine Wehrpflicht als Ursache nationaler Einheit, sondern gaben einer bereits existierenden nationalen Erhebung und einem Gefühl der Verbundenheit eine Form. Das Volk erhob sich im Kampf gegen Napoleon, und die neue Armee war die Gestalt, die diesem inneren Impuls verliehen wurde.
Mit anderen Worten: Zunächst gab es das Volk, dann die Form; zunächst gab es die organische Bewegung, dann den Staat, der sie ordnete. Diese Überlegung legt nahe, dass die Wehrpflicht in der realexistierenden Bundesrepublik nicht der Anfang, sondern der Abschluss eines politischen Erneuerungsprozesses ist. Eine neue, verfassungsgemäße, nationale und demokratisch-reformierte Ordnung kann nicht durch die Wehrpflicht entstehen, sondern muss ihr vorausgehen.
Die Wehrpflicht setzt ein Volk voraus, das sich als solches versteht. Sie setzt einen Staat voraus, der Hüter dieses Volkes ist. Zudem wird eine politische Ordnung vorausgesetzt, die organisch und demokratisch ist – nicht funktionalistisch, nicht kosmopolitisch, nicht technokratisch –, in der bürokratische Streitereien der Vergangenheit angehören und der Staat nicht mehr Krieg gegen das Volk führt. Solange das Eigene nicht wiederhergestellt ist, bleibt die Wehrpflicht ein leeres Gefäß. Und ein leeres Gefäß kann nichts aufnehmen. Erst wenn der Inhalt zurückkehrt, kann die Form entstehen.
Wem soll hier also noch die Treue geschworen werden? Treue ist an die Wahrheit gebunden und nicht an den Befehl. Und ein Opfer ist an Legitimität gebunden, nicht an Macht. Ein Staat, der sein Volk nicht schützt, verliert seine Substanz. Umgekehrt gilt: Ein Staat, der seine Legitimität verliert, verliert seine Substanz. Die heutige Bundesrepublik nutzt bekannte, aber leeren Formen wie die Wehrpflicht und versucht, deren Wesen und Gehalt, ermöglicht durch nationale Solidarität, irrigerweise auf die kosmopolitische Menschheitsrepublik, ähnlich wie in der DDR, anzuwenden. Dabei vergisst sie: Der Wehrpflichtige ist nicht nur Soldat, sondern auch Deutscher und Mitträger Deutschlands. Wenn er aber nur Soldat ist, dann ist er lediglich Untertan.
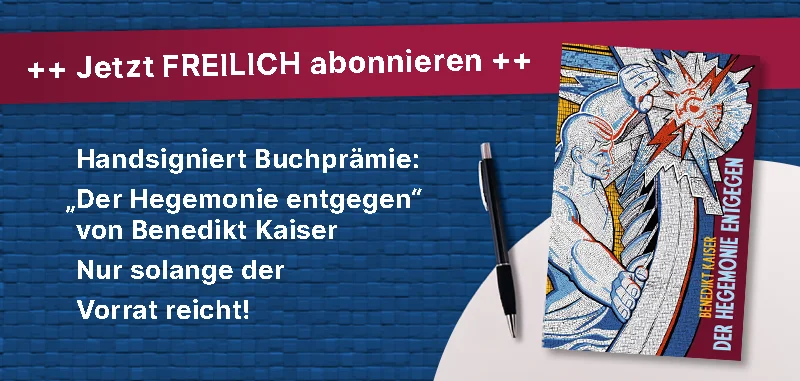




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!